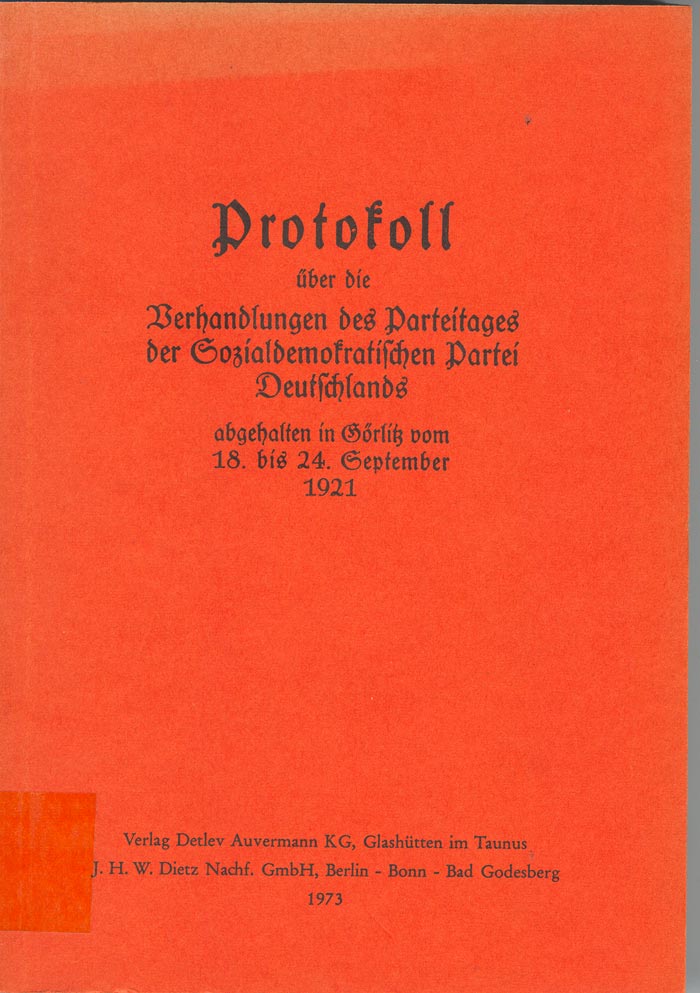Das Görlitzer Programm von 1921 und das Heidelberger Programm von 1925
Einführung
Der Beschluss zur Ausarbeitung eines neuen Parteiprogramms fiel auf dem Kasseler Parteitag der SPD im Oktober 1920. Das  Erfurter Programm von 1891, dessen allgemeiner Teil der damalige Chefideologe der SPD,
Erfurter Programm von 1891, dessen allgemeiner Teil der damalige Chefideologe der SPD,  Karl Kautsky, in enger Anlehnung an das 24. Kapitel des Marxschen "
Karl Kautsky, in enger Anlehnung an das 24. Kapitel des Marxschen " Kapital" ausformuliert hatte, galt als nicht mehr zeitgemäß und wurde der neuen Rolle der SPD als Staatspartei nicht mehr gerecht. Einen grundsätzlichen Wandel der SPD von der Klassen- zur Volkspartei hatten die Initiatoren des neuen Parteiprogramms freilich zunächst nicht beabsichtigt. Den "Mutterboden" der Partei wollte man ausdrücklich nicht verlassen.
Kapital" ausformuliert hatte, galt als nicht mehr zeitgemäß und wurde der neuen Rolle der SPD als Staatspartei nicht mehr gerecht. Einen grundsätzlichen Wandel der SPD von der Klassen- zur Volkspartei hatten die Initiatoren des neuen Parteiprogramms freilich zunächst nicht beabsichtigt. Den "Mutterboden" der Partei wollte man ausdrücklich nicht verlassen.
Das zeigte sich bereits an der personellen Besetzung der Programmkommission. Der " Revisionist"
Revisionist"  Eduard Bernstein, der noch vor der Jahrhundertwende Zweifel an der im Erfurter Programm prognostizierten gesellschaftlichen Entwicklung weg von Kleinbetrieben hin zu kapitalistischen Großbetrieben geäußert hatte, war nicht in das 7-köpfige Gremium berufen worden. Dessen Vorsitz hatte der Parteiveteran
Eduard Bernstein, der noch vor der Jahrhundertwende Zweifel an der im Erfurter Programm prognostizierten gesellschaftlichen Entwicklung weg von Kleinbetrieben hin zu kapitalistischen Großbetrieben geäußert hatte, war nicht in das 7-köpfige Gremium berufen worden. Dessen Vorsitz hatte der Parteiveteran  Hermann Molkenbuhr übernommen, der schon an der Ausarbeitung des
Hermann Molkenbuhr übernommen, der schon an der Ausarbeitung des  Gothaer Programms von 1875 und des Erfurter Programms mitgearbeitet hatte. Molkenbuhr, einer der profiliertesten Sozialpolitiker der SPD und überzeugter Befürworter einer Koalitionspolitik, stand für Kontinuität.
Gothaer Programms von 1875 und des Erfurter Programms mitgearbeitet hatte. Molkenbuhr, einer der profiliertesten Sozialpolitiker der SPD und überzeugter Befürworter einer Koalitionspolitik, stand für Kontinuität.
Dass Bernstein dann doch noch als Spiritus rector des allgemeinen Teils des Programms eine wichtige Rolle spielte, dürfte koalitionsstrategische Gründe gehabt haben. Die SPD hatte sich im Mai 1921 entschlossen, in die Regierung  Wirth (
Wirth ( Zentrum) einzutreten, nachdem sie noch auf dem Kasseler Parteitag die Sozialisierung der dafür reifen Industriezweige als unumstößliche Vorbedingung für den Eintritt in eine bürgerliche Koalition postuliert hatte. Ein Festhalten am Klassenkampfdogma schien mit der Realität der Koalitionspolitik nicht vereinbar.
Zentrum) einzutreten, nachdem sie noch auf dem Kasseler Parteitag die Sozialisierung der dafür reifen Industriezweige als unumstößliche Vorbedingung für den Eintritt in eine bürgerliche Koalition postuliert hatte. Ein Festhalten am Klassenkampfdogma schien mit der Realität der Koalitionspolitik nicht vereinbar.
Die Abkehr von alten Parteipositionen war dann auch der Hauptgrund dafür, dass ein von der Programmkommission im Juli 1921 vorgelegter erster Entwurf beißender Kritik verfiel. Dass Begriffe wie " Arbeiterklasse" und "
Arbeiterklasse" und " Klassenkampf" im Programmentwurf nicht vorkamen, dass die Sozialisierung nicht mehr zu den Zielen der Partei gehören sollte, empörte nicht nur den linken Flügel der Partei. Auch der spätere SPD-Parteivorsitzende
Klassenkampf" im Programmentwurf nicht vorkamen, dass die Sozialisierung nicht mehr zu den Zielen der Partei gehören sollte, empörte nicht nur den linken Flügel der Partei. Auch der spätere SPD-Parteivorsitzende  Kurt Schumacher, der sich beredt für den Eintritt der SPD in die Regierung Wirth eingesetzt hatte, fand es "schmerzlich", dass das Wort "Klassenkampf" im Programmentwurf fehlte. Darüber hinaus war er ungehalten darüber, dass weder ein Konzept der
Kurt Schumacher, der sich beredt für den Eintritt der SPD in die Regierung Wirth eingesetzt hatte, fand es "schmerzlich", dass das Wort "Klassenkampf" im Programmentwurf fehlte. Darüber hinaus war er ungehalten darüber, dass weder ein Konzept der  Wirtschaftsdemokratie entworfen noch eine sozialistische Staats- und Rechtslehre entwickelt worden war.
Wirtschaftsdemokratie entworfen noch eine sozialistische Staats- und Rechtslehre entwickelt worden war.
Die allermeisten dieser Kritikpunkte versuchte die Programmkommission zu berücksichtigen. In einer überarbeiteten Vorlage erklärte sie die "Überwindung des kapitalistischen Wirtschaftssystems durch eine die Wohlfahrt aller Gesellschaftsmitglieder sichernde sozialistische  Gemeinwirtschaft" zum Ziel. Außerdem, so hielt die Programmkommission fest, sei der "Klassenkampf der Arbeiterklasse und der sich mit ihr solidarisch fühlenden Gesellschaftsschichten" unumgänglich für ihre "wirtschaftliche Befreiung und kulturelle Hebung".
Gemeinwirtschaft" zum Ziel. Außerdem, so hielt die Programmkommission fest, sei der "Klassenkampf der Arbeiterklasse und der sich mit ihr solidarisch fühlenden Gesellschaftsschichten" unumgänglich für ihre "wirtschaftliche Befreiung und kulturelle Hebung".
Obwohl der Programmkommission, die auf dem Görlitzer Parteitag eingesetzt wurde, auch linke Kritiker wie  Max Seydewitz und
Max Seydewitz und  Heinrich Stroebel angehörten, wurden diese Zielsetzungen innerhalb der Partei wiederum als zu radikal empfunden und zurückgenommen. Den "Klassenkampf" stufte das Gremium daraufhin zum historischen Faktum herab. Andere strittige Programmpunkte hingegen ließ man bei der Suche nach Kompromissen offen, wie sich bei der Formulierung "Überführung der großen konzentrierten Wirtschaftsbetriebe in die Gemeinwirtschaft" zeigte. Dieses Postulat blieb absichtlich vage, da die Programmkommission sich "selbst nicht darüber klar war, was unter Gemeinwirtschaft zu verstehen" sei.
Heinrich Stroebel angehörten, wurden diese Zielsetzungen innerhalb der Partei wiederum als zu radikal empfunden und zurückgenommen. Den "Klassenkampf" stufte das Gremium daraufhin zum historischen Faktum herab. Andere strittige Programmpunkte hingegen ließ man bei der Suche nach Kompromissen offen, wie sich bei der Formulierung "Überführung der großen konzentrierten Wirtschaftsbetriebe in die Gemeinwirtschaft" zeigte. Dieses Postulat blieb absichtlich vage, da die Programmkommission sich "selbst nicht darüber klar war, was unter Gemeinwirtschaft zu verstehen" sei.
Mit diesen bissigen Worten kommentierte Heinrich Ströbel, der auf dem Parteitag die Einwände der Kritiker des Programmentwurfs formulierte, den überarbeiteten Entwurf. Während Ströbel einen "erkennbaren Weg für die Sozialisierung" vermisste, warnte der Chefredakteur des " Vorwaerts",
Vorwaerts",  Friedrich Stampfer, vor einem "neuen Utopismus" und der Gefahr einer "Sozialisierungsprophetie". Damit gestand er freilich auch ein, dass die SPD noch immer nicht über eine präzise Vorstellung von einer sozialistischen Wirtschaftsordnung verfügte, obwohl es keiner wagte, den Sozialismus als Ziel sozialdemokratischer Politik in Frage zu stellen. Nur Bernstein wünschte, dass dem Wort Sozialismus das Adjektiv "demokratisch" vorangestellt werde.
Friedrich Stampfer, vor einem "neuen Utopismus" und der Gefahr einer "Sozialisierungsprophetie". Damit gestand er freilich auch ein, dass die SPD noch immer nicht über eine präzise Vorstellung von einer sozialistischen Wirtschaftsordnung verfügte, obwohl es keiner wagte, den Sozialismus als Ziel sozialdemokratischer Politik in Frage zu stellen. Nur Bernstein wünschte, dass dem Wort Sozialismus das Adjektiv "demokratisch" vorangestellt werde.
Für die Mehrheit der Parteitagsteilnehmer hatte ganz offensichtlich die Sozialisierungsforderung nur noch untergeordnete Bedeutung. Im zweiten Teil des Programms, in dem die aktuellen Tagesforderungen aufgelistet waren, wurde die Sozialisierung zumindest eingeschränkt auf die Überführung von "Grund und Boden", der "Bodenschätze" sowie der "natürlichen Kraftquellen, die der Energieerzeugung dienen", in den "Dienst der Volksgemeinschaft".
Das Görlitzer Programm, das am 23. September 1921 vom Parteitag gegen fünf Stimmen verabschiedet wurde, ging als "Sieg der Revisionisten" in die Geschichte der Sozialdemokratie ein. Erstmals präsentierte sich die SPD nicht mehr als proletarische Klassenpartei, sondern als linke Volkspartei, als "Partei des arbeitenden Volkes in Stadt und Land", die alle "körperlich und geistig Schaffenden" "zur Kampfgemeinschaft für Demokratie und Sozialismus" vereinigen wollte.
Der Umstand, dass kein anderes SPD-Programm der Weimarer Republik so um eine Öffnung der Partei bemüht war wie das Görlitzer, sollte jedoch nicht zu verschnellen Schlüssen verleiten. Anders als in der Forschung zuweilen zu lesen, war das Görlitzer Programm nicht unmittelbarer Vorläufer und Vorbild des 1959 verabschiedeten  Godesberger Programms, das erst den Wandel der SPD von einer Klassenpartei zu einer modernen Volkspartei markierte.
Godesberger Programms, das erst den Wandel der SPD von einer Klassenpartei zu einer modernen Volkspartei markierte.
Das Görlitzer Programm ist auch als eine Reaktion auf die Inflationszeit zu verstehen. Eine Verelendung nicht nur der Arbeiter, sondern auch der Mittelschichten, deren Lebensbedingungen auf "proletarische" herabzusinken drohten, stellte in den Jahren der massiven Geldentwertung eine reale Gefahr dar und war keineswegs nur ein der marxistischen Ideologie entlehntes Schreckgespenst.
Dass den Mittelschichten ein Statusverlust prophezeit wurde, dürfte freilich nicht ausschlaggebend dafür gewesen sein, dass sie überwiegend ablehnend auf das Görlitzer Programm reagierten. Die Milieugrenzen, die sich während der Revolutionszeit etwas gelockert hatten, verfestigten sich wieder. Der Brückenschlag zwischen Arbeiterschaft und Mittelschichten konnte so nicht gelingen. Aber auch an der SPD-Parteibasis begegnete man dem Görlitzer Programm mit größten Reserven. Die Mehrheit der einfachen Parteimitglieder verstand die SPD nach wie vor als umfassende Lebens- und Lagergemeinschaft, die sich gegen die bürgerliche Außenwelt abzuschotten und nicht mit dem "Klassengegner" zu kooperieren hatte.
Eine längere Auseinandersetzung mit dem ungeliebten Programm blieb der Parteibasis ohnehin erspart, denn es sollte das "kurzlebigste Programm in der Geschichte der Sozialdemokratie" (Miller) bleiben. Es wurde nur wenig später durch ein Aktionsprogramm ersetzt. Dieses Papier bereitete die im September 1922 vollzogene Wiedervereinigung der SPD mit der Unabhängigen Sozialdemokratie ( USPD) vor, die sich im April 1917 im Streit über die Bewilligung von Kriegskrediten von der Partei abgespalten hatte. Aus Rücksichtnahme gegenüber der weiter links stehenden USPD wies das Aktionsprogramm dem Klassenkampfgedanken in Anknüpfung an das Erfurter Programm wieder einen zentralen Stellenwert zu. Das Aktionsprogramm war dann der Ausgangspunkt für das 1925 verabschiedete Heidelberger Programm.
USPD) vor, die sich im April 1917 im Streit über die Bewilligung von Kriegskrediten von der Partei abgespalten hatte. Aus Rücksichtnahme gegenüber der weiter links stehenden USPD wies das Aktionsprogramm dem Klassenkampfgedanken in Anknüpfung an das Erfurter Programm wieder einen zentralen Stellenwert zu. Das Aktionsprogramm war dann der Ausgangspunkt für das 1925 verabschiedete Heidelberger Programm.
Das Heidelberger Programm gilt in der Forschung als der "ideologische Preis, den die Mehrheitssozialdemokratie für die Wiedervereinigung mit den Unabhängigen zahlte" (H. A. Winkler). Diese Interpretation greift jedoch zu kurz. In der Zeit der  Hyperinflation und der sich daran anschließenden Stabilisierungskrise hatten sich die sozialen Auseinandersetzungen in einem Maße verschärft, dass der Klassenkampf wieder ein Stück Realität wurde. Insbesondere bei der Reichstagswahl im Mai 1924 hatte die SPD zahlreiche Wählerstimmen an die
Hyperinflation und der sich daran anschließenden Stabilisierungskrise hatten sich die sozialen Auseinandersetzungen in einem Maße verschärft, dass der Klassenkampf wieder ein Stück Realität wurde. Insbesondere bei der Reichstagswahl im Mai 1924 hatte die SPD zahlreiche Wählerstimmen an die  KPD verloren. Nicht zuletzt aus diesem Grund musste es der Sozialdemokratie auch darum gehen, die "proletarischen" Wähler wieder für sich zu gewinnen. Zudem hatten Zentrum und
KPD verloren. Nicht zuletzt aus diesem Grund musste es der Sozialdemokratie auch darum gehen, die "proletarischen" Wähler wieder für sich zu gewinnen. Zudem hatten Zentrum und  DDP, die möglichen Koalitionspartner der SPD, schon 1922 erklärt, dass sie eine Koalition mit den Sozialdemokraten nur dann eingehen würden, wenn diese dort die Rolle des Juniorpartners spielten. Schranken wurden somit auch von bürgerlicher Seite aufgebaut.
DDP, die möglichen Koalitionspartner der SPD, schon 1922 erklärt, dass sie eine Koalition mit den Sozialdemokraten nur dann eingehen würden, wenn diese dort die Rolle des Juniorpartners spielten. Schranken wurden somit auch von bürgerlicher Seite aufgebaut.
Dem Heidelberger Programm lag ein Entwurf Karl Kautskys, des Vaters des Erfurter Programms, zugrunde, der zunächst mit der Programmarbeit betraut worden war. Der zum Chefideologen der SPD avancierte Finanztheoretiker  Rudolf Hilferding vermochte es jedoch nach Kautskys Wegzug nach Wien, der Vorlage als "einigender Mann in der Mitte" seinen Stempel aufzudrücken. Damit war das in Heidelberg verabschiedete Programm mehr als ein neuer Aufguss des Erfurter Programms. Es knüpfte zwar wieder an den historischen Materialismus an. So deklarierte das Programm die Zurückdrängung des Kleinbetriebs durch den "kapitalistischen Großbetrieb" zu einer "inneren Gesetzmäßigkeit". Zugleich schwor es aber der marxistischen Verelendungstheorie ab. Hilferdings Theorie des "organisierten Kapitalismus", nach der die Produktionsmittel in der Hand einer "kleinen Kapitalistenoligarchie" monopolisiert würden, ging in das Programm ebenso ein wie seine 1910 veröffentlichten Thesen über die Vorherrschaft des Finanzkapitals.
Rudolf Hilferding vermochte es jedoch nach Kautskys Wegzug nach Wien, der Vorlage als "einigender Mann in der Mitte" seinen Stempel aufzudrücken. Damit war das in Heidelberg verabschiedete Programm mehr als ein neuer Aufguss des Erfurter Programms. Es knüpfte zwar wieder an den historischen Materialismus an. So deklarierte das Programm die Zurückdrängung des Kleinbetriebs durch den "kapitalistischen Großbetrieb" zu einer "inneren Gesetzmäßigkeit". Zugleich schwor es aber der marxistischen Verelendungstheorie ab. Hilferdings Theorie des "organisierten Kapitalismus", nach der die Produktionsmittel in der Hand einer "kleinen Kapitalistenoligarchie" monopolisiert würden, ging in das Programm ebenso ein wie seine 1910 veröffentlichten Thesen über die Vorherrschaft des Finanzkapitals.
In anderen Punkten konnte Hilferding seine Vorstellungen allerdings nur bedingt oder gar nicht durchsetzten. Seine auf dem Heidelberger Parteitag ins Zentrum seiner Rede gestellte Forderung nach Wirtschaftsdemokratie, die 1928 von den Freien Gewerkschaften zum Programm erhoben wurde, fand nur im Aktionsprogramm und dort auch nur in rudimentärer Form Berücksichtigung. So war dort von der "Ausgestaltung des wirtschaftlichen Rätesystems zur Durchführung eines Mitbestimmungsrechts der Arbeiterklasse an der Organisation der Wirtschaft" die Rede. Im allgemeinen Teil des Programms wurde hingegen die "Verwandlung des kapitalistischen Privateigentums an den Produktionsmitteln in gesellschaftliches Eigentum" zum Ziel erklärt.
Die Freien Gewerkschaften hatten den im ursprünglichen Programmentwurf erhobenen Führungsanspruch der Partei gegenüber den Gewerkschaften, der Kautskys Auffassung des Primats der Partei gegenüber den Gewerkschaften entsprach, moniert und eine Streichung der entsprechenden Passagen erreicht.
Insgesamt hatte sich innerhalb der SPD aber nur wenig Widerspruch gegen den Programmentwurf geregt. Grundsätzliche Kritik war auf dem Parteitag allein von dem früheren Kommunistenchef  Paul Levi gekommen. Der wünschte sich eine Rückkehr zu den Grundsätzen des Erfurter Programms und lehnte jegliche Koalitionspolitik mit bürgerlichen Parteien ab. Selbst die Verfechter des Revisionismus, die sich in Görlitz durchgesetzt hatten, erhoben keinen Protest gegen das neue Programm. Innerhalb der Partei wurde es kaum diskutiert und "gegen ganz wenige Stimmen" in Heidelberg verabschiedet.
Paul Levi gekommen. Der wünschte sich eine Rückkehr zu den Grundsätzen des Erfurter Programms und lehnte jegliche Koalitionspolitik mit bürgerlichen Parteien ab. Selbst die Verfechter des Revisionismus, die sich in Görlitz durchgesetzt hatten, erhoben keinen Protest gegen das neue Programm. Innerhalb der Partei wurde es kaum diskutiert und "gegen ganz wenige Stimmen" in Heidelberg verabschiedet.
Das mag daran gelegen haben, dass die konkreten Tagesforderungen des Aktionsprogramms sich kaum von denen unterschieden, die bereits im Görlitzer Programm aufgelistet worden waren. Der Schutz der demokratischen Republik, der Kampf gegen die "Klassenjustiz", die Abschaffung der Todesstrafe, die Sicherung des Koalitions- und Tarifrechts, der Umbau der Sozialversicherung zu einer allgemeinen Volksfürsorge, die Erhaltung des Achtstundentages, die Trennung von Schule und Kirche sowie die Ausgestaltung des  Völkerbundes zu einem Instrument der Friedenspolitik standen 1921 wie 1925 auf der Agenda. Im Heidelberger Programm wurde allerdings zusätzlich, ausgehend von Hilferdings Imperialismustheorie, die "Bildung der Vereinigten Staaten von Europa" verlangt. Der Dualismus zwischen Theorie und Praxis, der für die SPD des Kaiserreichs geradezu kennzeichnend gewesen war, trat im neuen Programm wieder deutlich hervor.
Völkerbundes zu einem Instrument der Friedenspolitik standen 1921 wie 1925 auf der Agenda. Im Heidelberger Programm wurde allerdings zusätzlich, ausgehend von Hilferdings Imperialismustheorie, die "Bildung der Vereinigten Staaten von Europa" verlangt. Der Dualismus zwischen Theorie und Praxis, der für die SPD des Kaiserreichs geradezu kennzeichnend gewesen war, trat im neuen Programm wieder deutlich hervor.
So zugespitzt die klassenkämpferische Diktion des Heidelberger Programms auch war, man wird der Forschung nicht vorbehaltlos folgen können, die das 1925 verabschiedete neue SPD-Programm als eine Rückkehr der SPD ins "soziale Ghetto" (Braun) wertet. Denn zum einen hatte das Görlitzer Programm bei den Mittelschichten keine Resonanz gefunden. Zum anderen verstellte das Heidelberger Programm nicht den Weg der Koalitionspolitik. Indem dort die Eroberung der politischen Macht zum Königsweg erklärt wurde, war es der SPD verwehrt, unter Berufung auf das neue Programm wieder in die alte Rolle der geborenen Oppositionspartei zu schlüpfen. So war es gerade Hilferding, der auf dem Kieler Parteitag 1927 in einer programmatischen Rede, aufbauend auf seiner Theorie des "organisierten Kapitalismus" und in Fortführung der Grundsätze des Heidelberger Programms, der Koalitionspolitik der SPD eine neue Legitimierung und Dignität geben sollte und so den linken Koalitionsgegnern eine Niederlage bereitete.
Petra Weber