Resolution „Über die Zeitschriften Zvezda und Leningrad“: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
K Coppenrath verschob die Seite Resolution „Über die Zeitschriften Zvezda und Leningrad“ nach Resolution „Über die Zeitschriften Zvezda und Leningrad“ |
(kein Unterschied)
| |
Version vom 15. August 2024, 13:57 Uhr
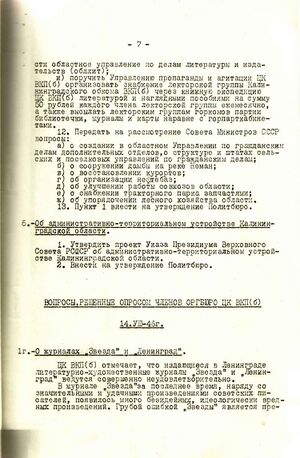
Der Beschluss des Orgbüros des CK der VKP(B) „Über die Zeitschriften ‚Zvezda‘ und ‚Leningrad‘“ vom 14. August 1946 ist im Kontext der mehrstufigen Disziplinierung der Kultur, der Gesellschaft und des Staats in der Nachkriegssowjetunion zu sehen, der Stärkung des Zentralismus und der hierarchischen Prinzipien der Staatsführung, und ebenso der sukzessiven Bestätigung der vom Standpunkt des stalinistischen Regimes legitimen ideologischen und ästhetischen Werte und Normen. Dieses Dokument drückte das Streben der Führung der kommunistischen Partei und des sowjetischen Staates aus, nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs und dem Beginn des globalen „Kalten Krieges“ zwischen dem „sozialistischen Osten“ und dem „kapitalistischen Westen“ mit den USA an der Spitze, die Kultur, und insbesondere die Literatur zu „zähmen“, ihre Macht und Kontrolle über sie auf dem Weg der Optimierung der ideologischen und politischen Kontrolle zu verstärken. Die Literatur und Kunst sollten zu den Werten und Normen wie Parteilichkeit, Volkstümlichkeit, Patriotismus und Heroismus zurückkehren, an deren Bedeutung die Autoren des Beschlusses erinnerten. Zur gleichen Zeit stellte das Sowjetvolk eine neue historische Gemeinschaft dar, was auch zur weiteren Festigung der Macht Stalins beitrug.
Jedoch war der vorliegende Beschluss auch eine Folge des Kampfes um die politische Macht auf den höchsten Ebenen der Partei- und Staatsführung, im Besonderen, der Rivalität zwischen Moskauer und Leningrader Gruppierungen. Er bekräftigte mittelbar das alleinige Machtmonopol des CK der VKP(b). Der Vorwurf der Abspaltung von der Moskauer Führung an die Häupter der Leningrader Parteiorganisation wurde eine der zentralen Vorfälle der „Leningrader Affäre“. So wurden die Dichterin Anna Achmatova und der Schriftsteller Michail Zoščenko Opfer der sowjetischen Politik.
Постановление Оргбюро ЦК ВКП(б) «О журналах „Звезда“ и „Ленинград“» от 14 августа 1946 г. следует рассматривать в контексте многоуровневого дисциплинирования культуры, общества и государства в послевоенном СССР, укрепления централизма и иерархических принципов государственного управления, а также сукцессионного утверждения легитимных, с точки зрения сталинского режима, идеологических и эстетических ценностей и норм. Этот документ выразил стремление руководства коммунистической партии и советского государства – с окончанием Второй мировой войны и началом глобальной «холодной войны» между «социалистическим Востоком» и «капиталистическим Западом» во главе с США – «укротить» культуру, и, в частности, литературу, усилив свою власть над ней путем оптимизации системы идеологического и политического контроля. Литература и искусство должны были вернуться к таким ценностям и нормам, как партийность, народность, патриотизм и героизм, о важности которых напоминали авторы Постановления. В то же время советский народ представлялся новой исторической общностью, что способствовало и дальнейшему укреплению власти Сталина.
Однако Постановление также было следствием борьбы за политическую власть в высших эшелонах партийного и государственного руководства, в частности, соперничества между московской и ленинградской группировками. Оно косвенно утверждало единоличную монополию власти ЦК ВКП(б). Обвинение глав ленинградской партийной организации в обособлении от московского руководства станет одним из центальных событий «Ленинградского дела». Таким образом, поэтесса Анна Ахматова и писатель Михаил Зощенко стали жертвами советской политики.
1.
Dem Beschluss des Orgbüros des CK der VKP(b) „Über die Zeitschriften ‚Zvezda‘ und ‚Leningrad‘“ ging eine lange Periode der Korrektur der ideologischen Orientierungspunkte des stalinistischen Regimes voraus, die Schaffung eines neuen, patriotischen Diskurses. Beginnend mit 1934, im Zusammenhang der imperialen Großmachtaußenpolitik, der erwarteten Bedrohung von Seiten der sogenannten imperialistischen Mächte (in erster Linie des nationalsozialistischen Deutschlands), dem Aufbau des Sozialismus in einem Land, der Errichtung der stalinistischen Einparteiendiktatur und der Durchsetzung des Personenkults sowie der forcierten Industrialisierung und Kollektivierung der Landwirtschaft ging der sowjetische Staat vom Internationalismus zum Sowjetpatriotismus als Ideologie der gesellschaftlichen Konsolidierung, Integration und Mobilisierung über. Ihr Ziel war es, die Macht Stalins zu festigen, eine neue sowjetische Identität zu erziehen und zur Zunahme an Loyalität der Bürger gegenüber dem Sowjetstaat beizutragen. Neben dem Terror bedeutete dies die Schaffung eines zweiten, kulturellen Pfeilers des Regimes.
Der patriotische Umschwung fand seinen Ausdruck sowohl in der Selbstwahrnehmung der Anführer dieses Staates als auch in der Identität seiner Bürger. Die neue Ideologie, eine Art stalinistische Variante der Reichsidee, wurde auf dem Weg der offiziellen Propaganda und ebenso im Rahmen des Systems der stalinistischen Kultur, Bildung und Wissenschaft, einschließlich der offiziellen Geschichtsschreibung, verbreitet. Von seinem Charakter her stellte er einen Staatspatriotismus dar. Im Unterschied zum proletarischen Internationalismus nahmen in dieser Ideologie nicht mehr die „Klasse“, „die Diktatur des Proletariats und der armen Bauernschaft“, „die Weltrevolution“ und „die internationale Republik der Arbeiter“ den zentralen Platz ein, sondern die russische „Nation“, später das „Sowjetvolk“, „Vaterland“ („Heimat“), der Sowjetstaat und die Partei in der Person ihres Anführers Stalin. Der loyale sowjetische Bürger, dessen Gestalt im patriotischen Diskurs konstruiert wurde, war mit dem Staat sowohl auf der bewussten als auch der emotionalen Ebene verbunden. Der Komplex an Normen, die sein Denken und sein Verhalten regulierten, setzte nicht nur einen unbegrenzten Glauben und Liebe zum Vaterland voraus, sondern auch die Bereitschaft zur Selbstaufopferung. Damit appellierte die neue Ideologie an die nationale Identität der Russen, an ihr nationales Gefühl, das sie gleichzeitig mit ihren neuen, sowjetischen Elementen ergänzte.
Damals begann gleichzeitig mit der Bestärkung des Sowjetpatriotismus, zunächst in verhüllter Form, die Kritik des „Kosmopolitismus“ als seines Widersachers, es wurde das Feindbild in der Gestalt des „bürgerlichen Westens“ geschaffen. Im Gegensatz zum Sowjetpatrotismus war das Referenzobjekt des „Kosmopolitismus“, wenn man der sowjetischen Propaganda folgen möchte, „Europa“, „das Ausland“ und „die ganze Welt“. In den Jahren des Großen Vaterländischen Krieges[1] erhielt der sowjetische Patriotismus seine endgültige Gestalt. Indem er das Thema des Krieges, der der Große Vaterländische genannt wurde, usurpierte, verfestigte er sich nach dem Sieg der Sowjetunion über Hitler-Deutschland noch und die im Rahmen die Sowjetpatriotismus propagierten Werte sollten sich endgültig in mentale und Verhaltensnormen der sowjetischen Gesellschaft verwandeln. Demgegenüber wurde der „Kosmopolitismus“ jetzt als Gegennorm wahrgenommen. In der Literaturwissenschaft trat er durch die Komparatistik, inhaltliche und formale Beziehungen zwischen Literaturen, (im Besonderen in Form der sog. „wandernden Sujets“) zum Schaden des patriotischen, nationalen Zugangs zur Kultur, der deren Selbständigkeit und nationale Eigenart betonte, zutage. In der Literatur wurde das Prinzip der Volkstümlichkeit, das organisch in den sozialistischen Realismus eingeschrieben wurde, die offizielle Doktrin von Literatur und Kunst. Dadurch bildete sich nach Evgenij Dobrenko eine der „ideologischen Paradigmen“ der Ždanovščina heraus, in deren Kontext man nicht zuletzt den Beschluss des Orgbüros des CK der VKP(B) „Über die Zeitschriften ‚Zvezda‘ und ‚Leningrad‘“ vom 14. August 1946 betrachten muss.[2]
2.
Der patriotische Diskus war nur einer der Diskurse, die die Identität des sowjetischen Menschen in der stalinistischen Epoche konstruierten. Ein anderer Diskurs war der über den „sozialistischen Übermenschen“[3]. Denn der Kommunismus war nicht nur ein politisches und gesellschaftliches, sondern auch ein zivilisatorisches und anthropologisches Projekt. Hans Günther sprach seinerzeit über den Helden als „Herzstück sowjetischer Mythologie“ und über das Heroische als „einen unabdingbaren Bestandteil jeder totalitären Kultur“, das als „kollektives Produkt“ auftauchte, das von diesem Kollektiv mit Hilfe der Systeme der gesellschaftlichen Kommunikation, einschließlich der Wissenschaften und der Bildung, sozialer Praktiken, Diskurse und Metadiskurse geschaffen wurde.[4] Obwohl das Konzept des „sozialistischen Übermenschen“ im Verlauf von mindestens drei Jahrzehnten geschaffen wurde, begann die eigentliche „heroische Epoche“ der sowjetischen Kultur, deren politische Lobbyisten die sowjetischen Partei- und Regierungsfunktionäre und deren Protagonisten einzelne Vertreter des sowjetischen kulturellen Establishments waren, zu Ende der 1920er Jahre.
Gerade der Held war berufen, die Verkörperung des „höheren gesellschaftlich-biologischen Typus“ zu werden, der nach den Ideen eben von Leo Trockij im Stadium der sozialistischen Gesellschaft erscheinen musste. Gerade dem Helden als Ideal des sowjetischen Bürgers wurde eine erzieherische, sozial-pädagogische Funktion zugewiesen. Gerade er war dazu berufen, den Bürger für die Erfüllung der politischen und gesellschaftlichen Aufgaben zu mobilisieren, die ihm die Partei und der Staat stellten. Im Zuge der Durchsetzung der Doktrin des Sowjetpatriotismus erhielt dieser Held nationale Züge und wurde, im Besonderen „ein russischer Nationalheld“.[5] Ab den 1930er Jahren war der öffentliche Diskurs vom Geist des Heroischen durchdrungen. Es begann die Institutionalisierung des Heroischen. Ungeachtet des Widerstands linker Gruppen in der Kunst und Literatur, beispielsweise der Linken Front der Künste (LEF) und ebenso proletarischer Gruppen aus dem Umfeld des RAPP[6] wurde der Held in der Kunst des sozialistischen Realismus kanonisiert.
Im sowjetischen Diskurs musste es für den Helden einen Widersacher geben. So wurden dem Heroischen die „Dekadenz“, „Degeneration“ und der „Individualismus“ entgegengestellt, sie wurden in das Reich der bürgerlichen, kapitalistischen Gesellschaft verbannt. Das Gegenteil des „sozialistischen Übermenschen“ wurde nicht nur der „kleine Mensch“, sondern auch der „Dekadente“: der untätige, übermäßig zur Nachdenklichkeit und Zweifeln Geneigte, der für die Stimmung des Zerfalls und des Pessimismus anfällig war. Die Dekadenz, die in Russland in den 1890er Jahren bekannt wurde, war einer der Strömungen der Literatur und der Kunst in der Epoche der Moderne. Wenn in der Literaturszene Mitte des 19. Jahrhunderts dieser Begriff (auch: Dekadententum) anfänglich eine positive Konnotation hatte, lehnten ihn die Literaturkritiker mehr oder weniger kategorisch ab. Ihrerseits wurden die Schriftsteller der Dekadenz und die Helden ihrer Werke für die Kunst und Literatur der Epoche des sozialistischen Realismus Feinde, das „ästhetisch“ und „inhaltlich Fremde“.[7]
3.
Die Kritik an den Schriftstellern und Dichtern, für die die ästhetische Funktion der Literatur und Kunst im Vordergrund stand und nicht die ethische und gesellschaftlich-politische, und deren künstlerische Form der Werke mehr als der Inhalt bewegte, fand ihre Fortsetzung in der Diskussion um den sog. Formalismus.[8] Wie die Dekadenz war der Formalismus, die „formale Richtung“ oder die „formale Schule“ am Anfang eine selbstständige Richtung, aber nicht in der Literatur und Kunst, sondern in der Literatur- und Sprachwissenschaft.[9] Die Entstehung des Formalismus geht auf die OPOJaZ zurück, die Gesellschaft zum Studium der poetischen Sprache oder Gesellschaft zum Studium der Theorie der poetischen Sprache (1916-1925), zu der beispielsweise Viktor Šklovskij, Boris Ėjchenbaum, Jurij Tynjanov, Roman Jakobson und Osip Brik gehörten.
Schon in den 1920er Jahre wurde der Formalismus zu einer beliebten Zielscheibe von Vertretern der Kultur, die der Sowjetmacht nahestanden und nicht zuletzt der Beamten. Als Beispiel kann der Abschnitt „Formale Schule der Poesie und Marxismus“ im Buch von Leo Trockij „Literatur und Revolution“ (1923) dienen. Seinen Höhepunkt erreichte der Kampf gegen den Formalismus, ebenso wie der Kampf gegen die Dekadenz, während der politischen Kampagnen 1936-1937, in deren Verlauf die endgültige Bestätigung der heroischen Werte in der stalinistischen Gesellschaft und des sozialistischen Realismus in allen Richtungen der sowjetischen Kunst vor sich ging.
Die Kampagne wurde unter der Losung des Kampfes gegen den Formalismus, „dekadenten Experimentalismus“ und „Ästhetitizismus“ geführt. Nach Meinung vieler Vertreter des stalinistischen kulturellen Establishments war das Ergebnis des Interesses an der formalen Seite eines Werks die Unterschätzung seiner ideologischen Botschaft und politisch-erzieherischen Funktion. Wie die Dekadenz, wurde der Formalismus für ein Symbol des literarischen und außerdem auch des ideologischen Nonkonformismus gehalten. Insgesamt wurden zum Formalismus die Strömungen in der Literatur und Kunst gezählt, deren Ästhetik nicht den Prinzipien des sozialistischen Realismus entsprach, d.h. prägnante Erscheinungen der Kultur der Moderne aus der vorrevolutionären Zeit, in der darstellenden Kunst vom Symbolismus bis zum Futurismus und Abstraktionismus. Die Schöpfer der entsprechenden Werke wurden beschuldigt, dass ihre Arbeiten auf „volksfeindlichen Standpunkten“ stünden und die Volkstümlichkeit war eine der Prinzipien des sozialistischen Realismus, und ebenso, dass sie das Prinzip des Realismus und der Natürlichkeit der Sprache verletzten, in Formalismus verfielen und außerdem noch in den Naturalismus, was als Erscheinung der Kleinbürgerlichkeit in der Kunst betrachtet und mit politischer Gleichgültigkeit gleichgesetzt wurde.
Die Kampagne wurde mit dem Artikel „Chaos statt Musik. Über die Oper ‚Lady Macbeth von Mzensk‘“ begonnen, der in der Pravda vom 28. Januar 1936 erschien. In ihm wurden zum ersten Mal die Beschuldigungen in konzentrierter Form zum Ausdruck gebracht. Um die Kampagne mit Hilfe der Autorität des lebenden Klassikers des sozialistischen Realismus, Maksim Gor`kij, zu legitimieren, druckte die Pravda am 9. April 1936 dessen Artikel „Über den Formalismus“ ab. Im Jahr 1937 druckte die Zeitschrift Zvezda den antidekadenten Artikel desselben Gor kij „Paul Verlaine und die Dekadenten“ von 1896 nach, der zum ersten Mal an der Schwelle vom 19. zum 20. Jahrhundert veröffentlicht worden war. Die Formen der Verfolgung der missliebigen Kulturschaffenden waren die verschiedensten, von Angriffen in der Presse bis zu administrativen Maßnahmen und dem Boykott des Werkes. Die Opfer der Kampagne wurden Schriftsteller, Künstler, Komponisten und Regisseure. Verfolgungen sahen sich im Besonderen der Komponist Dmitrij Šostakovič, der Theaterregisseur Vsevolod Mejerchol`d und der Kinoregisseur Sergej Ėjzenštejn ausgesetzt. Mit der Zeit verlor der Begriff des Formalismus seine Verbindung zu den wirklichen Vertretern der „formalen Richtung“, sein Sinn änderte sich, alle Schriftsteller und Kunstschaffenden wurden dessen beschuldigt, die den Fragen der künstlerischen Form große Aufmerksamkeit schenkten.
4.
Die Mehrzahl der Autoren, die die Geschichte der sowjetischen Kultur in der stalinistischen Periode untersuchen, betrachten den Beschluss „Über die Zeitschriften ‚Zvezda‘ und ‚Leningrad‘“ im Kontext der Kulturpolitik der kommunistischen Partei und des sowjetischen Staates.
Ab Ende der 1920er Jahre begann die VKP(b) die bestimmende Rolle in der sowjetischen Kunst zu beanspruchen. Gleichzeitig wurde der Prozess der ideologischen, ästhetischen und institutionellen Verstaatlichung der Kultur und im Besonderen der Literatur in Gang gesetzt. Es wurde ein System der direkten und indirekten Kontrolle über die Vertreter der Kunst etabliert. Seine Hauptelemente waren ein mehrstufiges System der Zensur, der sowjetische Schriftstellerverband (SSP), der 1932 nach der Auflösung der einzelnen Schriftstellervereinigungen gegründet wurde, ein zentralisiertes System der Verlage und der Distribution der Kultur- und literarischen Produktion sowie die Erziehung von „Kadern der Kultur“. Die Kontrolle wurde mit Hilfe ideologischer Kampagnen (beispielsweise gegen den Formalismus im Jahr 1936), der Gewährung von materiellen Privilegien und prestigereichen Auszeichnungen (eine solche war, beispielsweise, die 1940 geschaffene Stalinprämie) für loyale Kulturschaffende, der Einmischung in den Prozess des Schaffens von literarischen Werken sowie dem Verbot der einen und der Unterstützung anderer Autoren, d.h. mit Belohnungen und Verboten, umgesetzt.
Die Kunst und Literatur wurden als Instrument der Politik für die Legitimierung der Sowjetmacht und die Hausbildung der Identität eines Sowjetbürgers und einer Sowjetgesellschaft betrachtet. Mit anderen Worten wurde die Kultur ein Mittel des social engineering. Jeder Kulturschaffende war, nach den Worten von Stalin selbst, „ein Ingenieur der menschlichen Seelen“. Die sowjetische Kultur, alle ihre Subjekte und Institute mussten den sozialen Auftrag erfüllen. Ihnen wurden die Aufgaben der Erziehung der Gesellschaft gestellt, ihre Interessen mussten mit den Interessen der Partei und des Staates zusammenfallen, d.h. mit den Interessen ihrer Führer, die im Namen des ganzen Sowjetvolkes sprachen.
Der sozialistische Realismus wurde offiziell zur grundlegenden (ästhetischen) Doktrin der sowjetischen Kultur erklärt. Eine der Konsequenzen wurde die Verfolgung der „dekadenten Literatur“ und der „dekadenten Dichtung“ und ebenso die Beschuldigung der Autoren des Formalismus. Schon in der Vorkriegszeit war eine Folge dieser Politik das Abfallen des inhaltlichen und ästhetischen Niveaus der sowjetischen Werke. Die Kulturschaffenden, die vom Standpunkt der stalinistischen offiziellen Kulturpolitik von den von ihr bestätigten inhaltlichen und formalen Normen abwichen, wurden Opfer von Einschränkungen, und in den Jahren des Großen Terrors litten sie auch als angebliche Parteigänger der politischen Opposition.
5.
Ein Jahr nach dem Großen Vaterländischen Krieg entstand in der Führung der Partei und der Regierung offensichtlich der Eindruck, dass die Bedeutung der sowjetischen Werte und Normen, ebenso wie ihr Einfluss auf die Kultur und der Grad deren Verstaatlichung an Kraft verloren hatte, und damit auch die Macht der Partei über die Gesellschaft schwächer geworden sei. Wer sich der gesellschaftlichen Wahrnehmung der Kulturpolitik der Kriegszeit zuwendet, kann in dieser schwierigen Periode auf deren Liberalisierung schließen, während für die Periode, die unmittelbar dem Kriegsbeginn voranging, harte Maßnahmen zur Bekräftigung der Macht der Partei und des Staates in der Sphäre der Kultur charakteristisch waren.[10]
Ein Jahr nach Kriegsende sagte der Dichter Nikolaj Tichonov, dass im Besonderen 1941-1942 die Schriftsteller ziemlich gut lebten, besonders wenn man diese Jahre mit der zweiten Periode des Krieges vergleicht.[11] Diese Meinung spiegelte die verbreitete Vorstellung wider, dass in den Jahren des Großen Vaterländischen Krieges die Partei, der Staat und die Gesellschaft in einem einzigen patriotischen Aufschwung verschmolzen, so dass die Schaffenden der Literatur und Kunst den bestehenden disziplinarischen und restriktiven Rahmen nicht als ernsthafte Beschränkungen wahrnahmen. In Wirklichkeit konzentrierte sich die Führung der UdSSR in der ersten Kriegszeit, ungefähr bis Winter 1942/43 auf die militärische Mobilisierung und die Konsolidierung des Landes und verließ vermutlich angesichts wichtigerer organisatorischer Aufgaben der Kriegszeit das ideologische und administrative Feld der Kultur und ging auf dem Weg der kulturpolitischen Konzessionen und mischte sich nur geringfügig in das kulturelle Leben ein und verzichtete auf administrative Maßnahmen und die öffentliche Verurteilung der Schuldigen.[12]
Jedoch verrichteten die Organe der Zensur ihre Arbeit wie zuvor. In den Fällen, in denen die Literatur und Kunst nicht der Prüfung durch die offiziellen ideologischen und ästhetischen Normen standhielten, mischten sie sich kompromisslos in den kulturellen Prozess ein. Diese Einmischung ging im Wesentlichen auf der „mittleren“ und „unteren“ Ebene vor sich. Nach dem radikalen Umschwung im Krieg nach der Schlacht von Stalingrad begann die allmähliche „Revision“ dieser sog. Liberalisierung auf „der höchsten Ebene“ und die Behauptung der früheren „Hegemonie“ der Partei und des Staates auf dem Gebiet der Kultur. Im Besonderen drückte sich dies in den Angriffen auf eben diesen Michail Zoščenko für sein Buch „Vor dem Sonnenaufgang“ (1943) aus. Jedoch war es noch weit bis zu dem Moment, an dem diese Politik radikale Formen annahm.
Unabhängig davon, ob es eine solche bewusste Liberalisierung der Kulturpolitik gab, begannen in der Kriegszeit Kulturschaffende die sowjetische Wirklichkeit kritischer zu bewerten. In dieser Zeit erschienen Werke, die kaum in die offizielle Linie passten. Im intellektuellen Milieu wuchsen Hoffnungen auf eine Reform des stalinistischen gesellschaftlich-politischen Systems nach der Herstellung des Friedens. Außerdem wurde die Erfahrung des Großen Vaterländischen Krieges für viele Bürger der UdSSR eine Erfahrung der interkulturellen Interaktionen, in deren Bereich ging nicht nur das Dritte Reich ein, unter dessen Besatzung und ideologischem Einfluss sich große und strategisch wichtige Territorien des europäischen Teils des Landes befanden, sondern auch die westlichen Länder, die der UdSSR weltanschaulich feindlich gesinnt waren, unter ihnen die Verbündeten in der Anti-Hitler-Koalition. Die Bolschewiki sahen die Gefahr darin, dass der „Körper“ der sowjetischen Kultur von dem „Virus“ einer fremden Ideologie „infiziert“ sei, und die Gesellschaft, und mit ihr auch die Kultur unter den Einfluss eines feindlichen Diskurses geraten seien und den Standpunkt des sowjetischen (oder russischen) Nationalismus verlassen hätten. Durch das Prisma der Kritik konnte sich die sowjetische Wirklichkeit als bei Weitem nicht so ideal entpuppen, wie sie der stalinistische Diskurs zeichnete. Als Folge davon entstand die Gefahr der Verbreitung oppositioneller Stimmungen, was eine Zerstörung des Konsenses zwischen Partei, Staat und Gesellschaft nach sich gezogen hätte.
Dieses Gefühl der herannahenden Gefahr wurde durch das Auftauchen eines neuen Denkens beim sowjetischen Menschen verstärkt, der durch den Krieg gegangen war, ein mutiger Mensch, mit Kämpfereigenschaften, voller Entschlossenheit, seine Interessen zu behaupten. Außerdem obwohl die sowjetische Gesellschaft vom Sieg am Kriegsende beflügelt und voller Willen zum Leben war, war sie von den materiellen und physischen Entbehrungen der letzten vier Jahre erschöpft und strebte merklich nach einer Atempause von den Schwierigkeiten und nach einer Erlösung von der übermäßigen Bevormundung durch den Staat und seinen Strafverfolgungsbehörden.
Jedoch war vom Standpunkt des Staates eine solche Lage in der Kultur und Gesellschaft aus einer Reihe von innen- und außenpolitischen Gründen nicht akzeptabel. Zu den innenpolitischen gehörte der wirtschaftliche Wiederaufbau der Sowjetunion, ihrer Industrie und Landwirtschaft nach Kriegsende, die von den sowjetischen Bürgern neue Opfer forderte.
Ein anderer Faktor, der in der Vorgeschichte der Annahme des Beschlusses vom 14. August 1946 seine Rolle spielte, war die außenpolitische Lage, im Besonderen, der Beginn des „Kalten Krieges“, der Zerfall der Anti-Hitler-Koalition, die Verschärfung der Beziehungen zwischen West und Ost, zwischen den USA und der UdSSR. Die Sowjetunion stand vor der Aufgabe, ihren Einfluss in der Welt zu bewahren, der um den Preis großer Anstrengungen in den Jahren des Großen Vaterländischen Krieges errungen worden war. Das Ideal des „sozialistischen Übermenschen“, des der Sowjetunion, dem russischen Volk, das die Stützen der sowjetischen Gesellschaft „trug“, der kommunistischen Partei und ihres Führers Iosif Stalin ergebenen Patrioten, wurde aktueller. „Kosmopolit“, „Pessimist“ und „Ästhet“, das war das Feindbild, dessen Züge, wie schon oben angemerkt wurde, sich noch in der Vorkriegszeit herauszubilden begann. Jetzt wurde dieses Bild vervollkommnet. Während der „Kosmopolit“ die Überlegenheit der UdSSR über den Westen und Amerika auf allen Gebieten des politischen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Lebens in Frage stellte und die „nationale Selbständigkeit“ und „nationale Eigenheit“ der russischen Kultur, also ihre Verschiedenheit vom Westen anzweifelte, war der Ästhet der übermäßigen Begeisterung für die künstlerische Form zum Schaden seines, in erster Linie ideologischen, Inhalts schuldig. Unter den Vertretern sowohl der ersten als auch der zweiten Gruppe dominierten sowjetische Kulturschaffende jüdischer Abstammung.
Im Zusammenhang damit erschien es der Führung der Partei und des Staates wichtig, noch einmal die Aufmerksamkeit der Gesellschaft auf die Werte und Normen des sowjetischen Systems zu richten, den früheren „liberalen Kurs“ einer Revision zu unterziehen und die Daumenschrauben fester anzuziehen, um die Identität des Sowjetbürgers zu festigen und die Möglichkeit seiner Identifikation mit dem feindlichen Westen auszuschließen und ebenso die Kultur zu disziplinieren, sie auf den Weg der Erfüllung des sozialen Auftrags zurückzuführen. Schließlich entsprang der Beschluss einem unverwechselbaren Drang des Sowjetsystems, die Vorherrschaft der Partei und des Staates über einzelne Personen zu bestätigen, seine richtungsgebende und kontrollierende Rolle im Kampf gegen informelle Vereinigungen verschiedener Protagonisten oder „Clans“ zu bekräftigen, die sich um die Literaturzeitschriften entwickelten und ihre „Paten“ unter den Vertretern der höchsten Partei- und Staatsnomenklatur hatten. In diesem Zusammenhang wurde das Dokument die nächste Etappe im Kampf Stalins und seiner Umgebung um die Macht, dessen Höhepunkt solche von der Regierung fabrizierten Prozesse wurden, wie die „Leningrader Affäre“, der Fall des Jüdischen Antifaschistischen Komitees oder die „Ärzteverschwörung“.
In den 1990er Jahren wandte sich der russische Forscher Denis Babičenko erneut dem Studium der Umstände des Erscheinens und der politischen Absicht des Beschlusses „Über die Zeitschriften ‚Zvezda‘ und ‚Leningrad‘“ zu. Er stützte sich auf Dokumente aus dem Russischen Staatlichen Archiv der sozial-politischen Geschichte (RGASPI) und kam zum Schluss, dass die Geschichte des Erscheinens dieses Dokuments und sein Ziel im Kontext der politischen Geschichte der zweiten Hälfte der 1940-er Jahre betrachtet werden müsse, und besonders im machtpolitischen Kontext und im Zusammenhang mit der Rivalität der Leningrader und Moskauer Gruppierungen in ihrem Kampf um die Vormachtstellungen im Staat.[13] Er berücksichtigt dies und erklärt so nicht nur die Zeit der Entstehung des Dokuments, sondern auch die Tatsache, dass als Sündenböcke gerade Leningrader Zeitschriften und ebenso die Dichterin Anna Achmatova und der Schriftsteller Michail Zoščenko, die für „Leningrader“ gehalten wurden, ausgesucht wurden.
Indem er sich auf die Absätze des Beschlusses vom 14. August bezieht, wo die Rede von Beschuldigungen an die Adresse der Leningrader Parteiführung ist, die angeblich einen groben politischen Fehler begangen und die Fehler der Zeitschriften übersehen hatte, und indem er die Aufmerksamkeit auf das Fehlen einer solchen Kritik an die Adresse von Parteiinstanzen in anderen Beschlüssen über die Kultur in dieser Periode richtet und darauf, dass es in den Anklagematerialien der „Leningrader Affäre“ Bezüge auf die „Zeitschriftenaffäre“ von 1946 gibt, zieht Babičenko das Fazit, dass der Beschluss vom 14. August 1946 der Leningrader Parteiführung einen der ersten Schläge versetzte und er zu einer Art Vorläufer der „Leningrader Affäre“ wurde.
Die Schlüsselfigur dieses „Schlags gegen Leningrad“ wurde Georgij Malenkov. Noch vor kurzen war er einer der einflussreichsten Vertreter der sowjetischen Parteispitze gewesen, dann fiel er bei Stalin in Ungnade, im Besonderen im Zusammenhang mit dem Fall gegen den Hauptmarschall der Luftstreitkräfte, A. Novikov, und dem Volkskommissar für Luftfahrtindustrie, A. Šachurin. Malenkov verlor als ihr unmittelbarer Mentor im CK der Partei seinen Posten als Sekretär und Leiter der Kaderarbteilung des CK der VKP(B). Der Niedergang Malenkovs bedeutete einen Aufstieg der „Leningrader“, in erster Linie von Ždanov und Kuznecov, die eine Reihe hoher Posten in der Parteiführung besetzten, darunter auch die Posten von Malenkov selbst. Jedoch wurde dieser rasch rehabilitiert und beschloss, sich an den „Leningradern“ zu rächen, und kritisierte und griff ihre Arbeit auf verschiedenen Gebieten, darunter auch in der Kultur, an.
Jedoch sollte man diesen Beschluss kaum als einen der Schritte zur planmäßigen Vorbereitung dieser großen politischen Affäre betrachten. Die Eingliederung des „Falls der Zeitschriften“ in die nachfolgende „Leningrader Affäre“ fand höchstwahrscheinlich nachträglich statt und wurde nicht im Voraus als ihr Bestandteil geplant. Eine solche Praxis entsprach gänzlich dem Geist des stalinistischen Regimes. Außerdem mag es sonderbar erscheinen, dass in der Öffentlichkeit als die Schlüsselfigur der ganzen Affäre, die gegen die Leningrader Parteiführung gerichtet war, Andrej Ždanov auftrat, der Lobbyist der „Leningrader“ auf den höchsten Ebenen der Macht. Folgte er nur seiner Pflicht gegenüber der Partei und seinem Posten? Wenn man nach den Erinnerungen der Zeitzeugen dieser Ereignisse urteilt, dann ist dies möglicherweise der Fall.
Jedoch leugnet derselbe Babičenko nicht, dass der vorliegende Beschluss eine kulturpolitische Stoßrichtung hatte. So betrachtet er ihn im Kontext der allgemeinen Verschärfung der sowjetischen Kulturpolitik ab dem Jahr 1943.[14] Somit stellt sich der Beschluss des Orgbüros des CK der VKP(b) „Über die Zeitschriften ‚Zvezda‘ und ‚Leningrad‘“ vom 14. August 1946 als eine der einschlägigen Maßnahmen dar, im Besonderen, neben dem Beschluss des Sekretariats des CK über die Erzählung von Aleksej Kapler „Die Briefe des Leutnants L. aus Stalingrad“ vom 15. Dezember 1942, in dem der Autor des „Antikünslterischen“ und der „Gekünsteltheit“ in der Darstellung der handelnden Personen beschuldigt wurde oder dem Veröffentlichungsverbot der Werke von Aleksander Dovženko mit seiner nachfolgenden Entfernung aus allen bisherigen Ämtern für seine Kinoerzählung „Der Sieg“ und dem Drehbuch „Ukraine im Feuer“, das angeblich im Geiste des „ukrainischen Nationalismus“ gehalten war (1943/44) und ebenso vieler anderer ähnlicher Schritte.[15]
Zu solchen Maßnahmen kann man auch eine Reihe von Beschlüssen über Literaturzeitschriften zählen, die zur Errichtung der Kontrolle über die publizistische und künstlerische Literatur in der sowjetischen Gesellschaft dienten, unter ihnen die Beschlüsse „Über die Kontrolle über literarisch-künstlerische Zeitschriften“ (1946 außer Kraft gesetzt), „Über die Erhöhung der Verantwortlichkeit der Sekretäre der literarisch-künstlerischen Zeitschriften (beide: Dezember 1943), „Über die Zeitschrift ‚Znamja‘“ (1944), die auf der Ebene des CK der VKP(B) gefasst wurden.[16] Nach offiziellen Einschätzungen wurde seit 1943-1944 die kritische Lage in der kulturellen Sphäre zu einem Thema vieler Besprechungen auf höchster Ebene, für gewöhnlich im Rahmen der Verwaltung für Propaganda und Agitation (UPA) des CK der VKP(B). Es ist jedoch bemerkenswert, dass die Objekte der Angriffe in diesen Fällen nicht nur die sowjetischen Kulturschaffenden und auch ihre Einrichtungen wie Verlage und die großen literarisch-künstlerischen Zeitschriften, d.h. praktisch alle Ebenen des literarischen und kulturellen Prozesses, waren, sondern auch Verwaltungseinrichtungen der sowjetischen Ideologie und Kultur und ihre Vertreter, die Verwaltung für Propaganda und Agitation des CK der VKP(B) und die Sekretäre der Verlage und Zeitschriften.[17]
Der Beschluss vom 14. August 1946 wiederholte in vielem die ideologischen und politischen Beschuldigungen und Argumente der entsprechenden früheren und späteren Dokumente. Ihre Autoren beschuldigten ihre Opfer ebenfalls der „ernsten Defizite“, „politischen Fehler“, des „politischen Schädlingstums“, des „Antikünstlerischen“, „Formalismus“, der „Verfälschung des Bildes des sowjetischen Menschen“ oder der „sowjetischen Wirklichkeit“ oder der „Unterwerfung unter Amerika“.[18] Schließlich wurden sie solcher gefährlichen Handlungen wie „Förderung der bürgerlichen Idee der Freiheit des Schaffens“ beschuldigt.[19] Wenn die Opfer der „verbalen Säuberungen“ Funktionäre der sowjetischen Kultur wurden, dann wurden gegen die literarisch-künstlerischen Zeitungen zusätzliche Beschuldigungen vorgebracht, deren wichtigste die „schwache Kontrolle“ über die Kultur und Literatur war, ebenso das Fehlen „des notwendigen ideologischen und literarisch-künstlerischen Niveaus“.
Hinter diesen Maßnahmen, Maßregeln und Aussagen versteckte sich allem Anschein nach die Furcht der Partei- und Staatsführer, den Einfluss nicht nur auf die Kultur, sondern auch auf das gesellschaftliche Bewusstsein zu verlieren, was den Verlust der Kontrolle über die Situation verhieß. Diese Befürchtungen, so scheint es, fanden ihre Bestätigung in den Geheimdienstberichten des Ministeriums für Staatssicherheit (MGB), in denen ein besonderer Nachdruck auf die „politisch unzuverlässigen Stimmungen und Aussagen der Schriftsteller“ gelegt wurde (dabei selbst von denjenigen, die generell ihre Loyalität zum stalinistischen Regime zeigten), ihre Unzufriedenheit mit der Redaktionspolitik der Verlage und Zeitschriften, und ebenso mit der Zensur, die sich im ersten Jahr nach dem Krieg erheblich verstärkte. Der offene Ausdruck dieser Unzufriedenheit wurde der Aufsatz des Schriftstellers Fedor Panferov „Über Schildkröten und Schädelsplitter“[20], der in der Zeitschrift Oktjabr` 1946 gedruckt wurde, in dem die Haltung der Zensoren und Literaturkritiker zur Literatur kritisiert wurde.[21]
Der Grund wiederum dafür, dass im gegebenen Fall die Leningrader Zeitschriften Zvezda und Leningrad und ebenso die Schriftsteller Anna Achmatova und Michail Zoščenko als Sündenböcke ausgewählt wurden, muss ebenso in der Situation dieser Zeitschriften in diesem Moment und im schöpferischen Schicksal der Dichterin und des Schriftstellers im Rahmen des sowjetischen Systems der Kultur gesucht werden.[22] Trotzdem darf man die Tatsache nicht aus dem Blick verlieren, dass Zvezda schon in dem Beschluss des Orgbüros „Über die Redaktionen der literarisch-schriftstellerischen Zeitschriften“ vom 20. August 1939 kritisiert worden war,[23] und ein Jahr vor der Annahme des Beschlusses vom 14. August 1946 wurde die Zeitschrift für die Veröffentlichung von „pessimistischen“ Gedichten einer Reihe sowjetischer Dichter kritisiert, d.h. das „Leningrader Revier“ wurde aus ideologischen und administrativen Gründen für eines der schwachen auf dem Gebiet des sowjetischen Zeitschriftenwesens gehalten.
Nach den Worten von Babičenko muss man im Kontext derselben politischen Umstände auch die Wahl von Anna Achmatova und Michail Zoščenko für die Rollen der Hauptbeschuldigten erklären. Achmatova selbst, obwohl sie nicht zu den in der Gunst der Macht stehenden sowjetischen Literaturschaffenden gehörte, wurde jedoch in der unmittelbar der Annahme des Beschlusses vorhergehenden Periode keinen Verfolgungen unterworfen. Im Jahr 1940 wurden entschiedene Maßnahmen gegen sie ergriffen, als „unter Vermittlung“ von Ždanov ein schon veröffentlichter Sammelband ihrer Gedichte „Aus sechs Büchern“ aus dem Verkehr gezogen wurde.[24] Im Besonderen wurde Achmatova damals beschuldigt, dass in ihren Werken die revolutionäre Thematik fehle und „die sowjetische Thematik über die Menschen im Sozialismus“.[25] Jedoch begann man später, ihre Gedichte erneut in literarisch-künstlerischen Zeitschriften zu veröffentlichen und ihre Bücher wurden in die Editionspläne der großen hauptstädtischen Verlage aufgenommen.[26]
Ein ähnliches Schicksal ereilte auch Michail Zoščenko. In den Kriegsjahren wurde er von Seiten der Vertreter des sowjetischen Kulturestablishments der Kritik für seinen Roman „Vor dem Sonnenaufgang“ unterworfen. Jedoch wurde Zoščenko im Juni 1946 Mitglied des Redaktionskollegiums der Zeitschrift Zvezda; hier wurden seine Werke veröffentlicht, eben die Erzählung „Abenteuer eines Affen“, die einer der Beweise der „Schuld“ des Schriftstellers wurde, der tatsächlich in diesem Werk den „sowjetischen Kleinbürger“ entlarvte und damit indirekt die erzieherische Funktion des sowjetischen Systems, dessen Anstrengungen zur Schaffung des sowjetischen „neuen Menschen“ in Zweifel zog. Selbst einen Monat vor dem Erscheinen des Beschlusses konnte man in der Leningrader Parteipresse positive Bewertungen des Werks des Schriftstellers finden.[27] Die Tatsache, dass die Wahl auf Achmatova und Zoščenko fiel, wird nur teilweise durch die Form und den Inhalt ihres Schaffens erklärt und auch durch dessen Einschätzung „von oben“. Vielleicht muss man eine andere Erklärung in der Tatsache ihrer „Leningrader“ Herkunft suchen, die eine verhängnisvolle Rolle spielte, wenn man die „Anti-Leningrader“ Ausrichtung des Beschlusses selbst in Betracht zieht.
Wenden wir uns den Ereignissen zu, die dem Erscheinen des Beschlusses vom 14. August 1946 unmittelbar vorausgingen. Eines von ihnen ist die Besprechung vom 18. April 1946 bei Ždanov, die den Fragen der Propaganda und Agitation gewidmet war.[28] Babičenko spricht dieser Sitzung eine Schlüsselrolle in der Vorbereitung des Beschlusses, der Bestimmung dessen Opfer (und, womöglich, seiner Ausführenden) zu. Die Grundthemen waren, im Besonderen, der Zustand der sowjetischen Literatur und ihre Anleitung. Die Auftretenden, darunter Ždanov, bemerkten das „unzureichend“ hohe Niveau der Kunstwerke und ebenso die „Unzulänglichkeit“ der Arbeit der Vertreter der Behörden für Kulturangelegenheiten, der Verwaltung für Propaganda und Agitation und der Literaturkritiker als hauptsächlichen Einrichtungen für den Kampf mit den „dicken Zeitschriften“ und den illoyalen Schriftstellern. Als Negativbeispiele wurden die Zeitschriften Novyj Mir und Zvezda genannt. Im Wesentlichen wurden auf dieser Versammlung die Erwägungen, die Stalin einige Tage zuvor, auf der Sitzung des Politbüros des CK der VKP(b) vom 13. April 1946 ausgesprochen hatte, zur Kenntnis genommen. Nach den Worten von Ždanov war der Generalsekretär selbst besonders mit den zwei obengenannten Zeitschriften äußerst unzufrieden. Als Ergebnis der Sitzung zog Ždanov die Schlussfolgerung, dass, um die entsprechende Forderung Stalins zu erfüllen, die Führung der sowjetischen Literatur vervollkommnet werden müsste, im Besonderen müsste die Arbeit der Verwaltung für Propaganda und Agitation optimiert werden, die für die Literaturkritik verantwortlich war. Er spielte auch darauf an, dass es möglicherweise notwendig sei, die Zahl der herausgegebenen Zeitschriften zu vermindern. Jedoch wurden unmittelbar darauf keinerlei konkreten Schritte unternommen.
Die bürokratische Maschine der Verwaltung der sowjetischen Kultur arbeitete erst nach drei Monaten wieder. In der Denkschrift von Aleksandrov und Egolin an Ždanov vom 7. August 1946 ging es, ausgehend von ihrer Bezeichnung, unmittelbar um den „unbefriedigenden Zustand der Zeitschriften ‚Zvezda‘ und ‚Leningrad‘“. Die Autoren des Dokuments schlugen eine Reorganisierung des Redaktionskollegiums der Zvezda und die Abschaffung von Leningrad vor.[29] An den Bericht wurde ein Projekt eines entsprechenden Beschlusses des CK angehängt.
Die weiteren Ereignisse entwickelten sich nach folgendem Muster. Am 9. August fand die Sitzung des Orgbüros des CK der VKP(b) statt, bei der Stalin, Malenkov und der erste Sekretär des Leningrader Stadtkomitees der VKP(b), Popkov, anwesend waren.[30] Eine der erörterten Fragen war die Situation der Zeitschriften Zvezda und Leningrad. Ebenso wie in der Denkschrift von Aleksandrov und Egolin[31] wurden auch auf der Sitzung des Orgbüros des CK der VKP(b) Anna Achmatova und Michail Zoščenko zum Gegenstand der Kritik und außer ihnen noch eine Reihe anderer Schriftsteller, die in diesen Zeitschriften veröffentlicht wurden. Wenn man die erstere der „Untergangsstimmungen im Werk“ beschuldigte, der Bedeutungslosigkeit ihres poetischen Schaffens (darum ging es im Beitrag von Stalin selbst), so liefen die Beschwerden gegen Zoščenko darauf hinaus, dass er angeblich „spöttisch“ die „Beschwernisse des Lebens unseres Volkes in den Kriegstagen“ beschrieben habe und die sowjetischen Menschen als „sehr primitiv“ und „beschränkt“ darstellte, sie „verblödete“.
Dabei legte Stalin selbst, wie Babičenko meint, eine erstaunliche Unkenntnis des Schaffens dieses Schriftstellers an den Tag. Als es um die Leningrader „dicken Zeitschriften“ selbst ging, war seine Einschätzung ihrer Tätigkeit, nach der zutreffenden Bemerkung des Forschers, genau so negativ wie die Bewertung der Tätigkeit der entsprechenden Moskauer Organe. Bemerkenswert ist die Tatsache, dass es im Projekt des Beschlusses zunächst nicht um einzelne Anführer der Leningrader Parteiorganisation ging. Unter den Verwaltungsorganen, die der Kritik unterzogen wurden, tauchten die UPA des CK der VKP(b) und die Abteilung für Propaganda des Leningrader Stadtkomitees der VKP(b) auf.[32] Aber auf der Sitzung des Orgbüros war die Lage schon anders. Während zunächst die „anti-Leningrader“-Haltung von Stalin nicht offensichtlich war, war dies zweifellos bei Malenkov der Fall. Gerade er schrieb die Schuld an den Unzulänglichkeiten in der Arbeit der Leningrader Zeitschriften dem ganzen Leningrader Stadtkomitee der VKP(b) zu und bewirkte die Umwandlung des Falls der Leningrader Zeitschriften auch noch in den Fall der Leningrader Parteiführer.[33]
Es ist bemerkenswert, dass man schon damals die Leningrader Parteiführer nicht nur des niedrigen künstlerischen Niveaus der örtlichen Zeitschriften und ihrer schlechten Leitung beschuldigte, sondern auch, dass sie die Autorität der Partei- und Staatsführung in Moskau ruiniert hätten, indem sie nicht ihre Politik gegenüber den Zeitschriften mit dieser abgestimmt hätten. Charakteristisch war die Reaktion von Ždanov, der, sobald sich die Gelegenheit bot, den bei der Sitzung des Orgbüros anwesenden Leningrader Parteiführern seine Unterstützung ausdrückte. Zu dieser Zeit traten selbst die „Leningrader“ nicht in einer einheitlichen Front auf. Zum Beispiel stellte sich Popkov in seinem Beitrag nicht auf die Seite der Leningrader Schriftsteller, sondern, im Gegenteil, versuchte er nur sie in allem zu beschuldigen.[34] Letztendlich war er unter dem Druck von Stalin und Malenkov dennoch gezwungen, mit einer Kritik seiner Arbeit hervorzutreten und eigene Fehler zuzugeben. Auch die Leiter der beiden Leningrader Zeitschriften übten sich in Selbstkritik. Was die Reaktion der Schriftsteller betrifft, die ins Orgbüro eingeladen worden waren, so waren nach dem Protokoll der Sitzung zu urteilen, die negativen Argumente, im Besonderen gegen Achmatova, für einen bestimmten Teil von ihnen unzureichend überzeugend. Im Gegenteil, das Werk genau der Achmatova wurde von ihnen als vollständig den Werten des „sowjetischen Menschen“ entsprechend eingestuft.
Obwohl bei der Ausfertigung der Schlussvariante des Textes des Beschlusses neben Ždanov noch andere Personen ihren Beitrag leisteten, erhielt die Periode der Kulturpolitik der UdSSR, deren Anfang der Beschluss vom 14. August 1946 legte, die Bezeichnung „Ždanovščina“, denn die veröffentlichten und weitbekannt werdenden Berichte, die den Sinn dieses Beschlusses erklärten, wurden vor allem von ihm vorbereitet. Schon im Vorfeld der Annahme des Beschlusses schalteten sich die Organe des MGB in den Fall ein, was schon für sich Zeugnis davon ablegte, dass die Partei die Literatur und Kunst ernst nahm. Gerade von ihnen wurde ein Dossier über Zoščenko zusammengestellt, das die Bestätigung des „antisowjetischen“ Charakters seiner ganzen schöpferischen Tätigkeit enthielt und das am 10. August 1946 an den Sekretär des CK der VKP(B), Aleksej Kuznecov, gesandt wurde.[35] Am 14. August 1946 wurde der Beschluss auf der Sitzung des Orgbüros angenommen.
6.
Entsprechend dem stalinistischen Diskurs begann der Beschluss mit der Aufzählung der Probleme, in diesem Fall mit der ideologischen Unreife und den Fehlkalkulationen der Redaktionen der Zeitschriften. Ebenso wurden die Ursachen der Fehler erklärt und die Schuldigen benannt. Dann wurden die Maßnahmen aufgezählt, die auf die Beseitigung der Unzulänglichkeiten und die Bestrafung der Schuldigen abzielten. Achmatova und Zoščenko waren den Autoren des Dokuments nicht an sich interessant, sondern als Sinnbilder des „Fremden“ oder der „Feinde“ des stalinistischen Staates und der Gesellschaft. Das Bild der beiden Literaten wurde im Text des Beschlusses entsprechend der Gestalt des „Fremden/Feindes“ der Epoche des Spätstalinismus konstruiert: „Antipatriot“, „Kosmopolit“, „Dekadenter“ und „Ästhet“.
So wurde Zoščenko in dem Beschluss „Scherzkeks“ und „Abschaum“ genannt, in der Erzählung „Abenteuer eines Affen“ legte er angeblich eine „geschmacklose Schmähschrift über den sowjetischen Alltag und den sowjetischen Menschen“ vor, stellte „das sowjetische System und die sowjetischen Menschen in verzerrter karrikierender Form dar und schildert die sowjetischen Menschen verleumderisch als primitive, unkultivierte Dummköpfe mit kleinbürgerlichem Geschmack und Wesen“ und seine „flegelhafte Darstellung“ „unserer Wirklichkeit“ wurde von „antisowjetischen Angriffen“ begleitet. Die Verbrechen von Achmatova, „deren literarisches und gesellschaftspolitisches Antlitz“, wie in dem Beschluss bekräftigt wurde, „schon längst der sowjetischen Öffentlichkeit bekannt ist“ waren anderer Art. Aus dem Text folgte, dass „Achmatova die typische Vertreterin einer unserem Volk fremden leeren, ideenlosen Poesie“ sei. „Ihre Gedichte, die vom Geist des Pessimismus und der Dekadenz getränkt sind, die den Geschmack der alten Salonpoesie ausdrücken, auf den Positionen des bürgerlich-aristokratischen Naturalismus und der Dekadenz erstarrt sind, ‚einer Kunst für die Kunst‘, da sie nicht wünscht, mit ihrem Volk Schritt zu halten, fügen der Sache der Erziehung unserer Jugend Schaden zu und können in der sowjetischen Literatur nicht geduldet werden“. Der Schriftsteller und die Dichterin wurden der „ideologischen Unreife“ und des „Apolitismus“ beschuldigt, die letztere zusätzlich der „Fremdheit vom Volk“. Es ist bemerkenswert, dass die Beschuldigungen des „Quasiformalismus“ in dem Beschluss eher an die Adresse Achmatovs und nicht Zoščenkos gerichtet waren, der in den 1920er Jahren mit den „Serapionsbrüder“[36] verbunden war, deren Mitglied der Formalist Viktor Šklovskij war; die Literaturkritiker rechneten mit leichter Hand Zoščenko eine Zeit lang sogar den Formalisten zu.
Ähnliche Beschuldigungen, verwässert mit Hinweisen auf Fakten der „Kriecherei vor der zeitgenössischen bourgeoisen Kultur des Westens“, „der Kriecherei gegenüber allem Ausländischen“ (das heißt im Kern „Kosmopolitismus“) und darauf, dass die Dichterin sich den Themen des „Schwermuts“, des „Pessimismus“ und der „Enttäuschung im Leben“ zugewandt habe, wurden auch gegen eine Reihe anderer Autoren, die in den beiden Zeitschriften gedruckt wurden, vorgebracht, ebenso wie gegen diese Zeitschriften als solche. In solch scharfer und konzentrierter Form tauchten die Beschuldigungen des Fehlens von Patriotismus oder des „Kosmopolitismus“ in einem offiziellen sowjetischen Dokument das erste Mal auf. Dabei überwogen Beschuldigungen ideologischer und ethischer Art eindeutig gegenüber Vorwürfen bezüglich der Ästhetik der Werke. Damit wurden Zoščenko und Achmatova der mangelnden Ergebenheit gegenüber den früher genannten offiziell bekräftigten Werten und Normen des Patriotismus, Heroismus, sozialistischen Realismus und der Politisierung der Literatur beschuldigt. Am Beispiel der Beschuldigten wurde die Diskrepanz zwischen ihrem individuellen Diskurs und dem Diskurs der Macht bekräftigt, und, besonders darin erschließt sich der Sinn dieser Passagen des Beschlusses, wurde die Forderung erhoben, diesen Werten und Normen streng zu folgen.
Jedoch waren das Objekt der offiziellen Kritik nicht nur und nicht so sehr die Werke von Achmatova und Zoščenko, als vielmehr die Tatsache ihrer Veröffentlichung. Ihrerseits verletzten die Zeitschriften Zvezda und Leningrad, insbesondere ihre Leitung in Person von V. M. Sajanov (Zvezda) und D. S. Licharev (Leningrad), indem sie eine Tribüne für die Werke der beiden boten, ebenso das Prinzip der Parteilichkeit der sowjetischen Kultur, das die Orientierung an den politischen Interessen der stalinistischen Partei und des Staates, am Diskurs der Macht, dem Prinzip der „Literatur als Politik“ postulierte. Denn sie hatten vergessen, dass sowjetische Zeitschriften „nicht unpolitisch sein können“, dass „sie sich deshalb davon leiten lassen müssen, was die Lebensgrundlage der Sowjetordnung bildet: ihre Politik“.
Ebenso wurde in dem Beschluss erwähnt, dass die bestimmende Kraft des literarischen und kulturellen Prozesses das Volk sei, dessen Meinung und Interessen von eben dieser Partei und dem Staat ausgedrückt würden. Folglich stellten die Zeitschriften und ihre Leitung den Interessen der Partei und des Volkes die Interessen einzelner Gruppen („freundschaftliche“, „persönliche“ Beziehungen) gegenüber und fügten sich nicht in das System der Macht und der Parteihierarchie ein. Damit verfielen sie, ähnlich den Literaturgruppen Ende der 1920er Jahre, der „Cliquenwirtschaft“ und stellten das System selbst in Frage, die Macht der Partei- und Staatsführung.[37] Besonders darin bestand die schlechte Leitung der literarisch-künstlerischen Zeitschriften Zvezda und Leningrad, die in dem Beschluss als „Liberalismus“ und „ernsthafte politische Fehler“ dargestellt werden. Indem sie die Redaktionen der Zeitschriften auf ihre Schuld hinweisen, strebten die Autoren des Dokuments letztendlich danach, die früher bestätigten Kräfteverhältnisse zwischen dem sowjetischen Staat, der Kultur und der Gesellschaft wiederherzustellen.
Der Beschluss ließ keinen Zweifel daran, worin eine der Hauptgefahren solcher Werke und einer solchen Veröffentlichungspolitik der Zeitschriften bestand: in ihrem „desorientierenden Einfluss auf die Jugend“, in der „Vergiftung ihres Bewusstseins“, der „Schädigung der Sache der Erziehung“ der sowjetischen Jugend. Er erinnerte seine Adressaten nachdrücklich an die erzieherische Funktion der sowjetischen Zeitschriften, und damit an die erzieherische Funktion der gesamten sowjetischen Kultur. Denn den Zeitschriften wurde die Aufgabe gestellt, die sowjetische Jugend im Geist der heroischen Werte zu erziehen, eine neue Generation lebensfroher, an ihre Sache Glaubender, die bereit waren alle Hindernisse zu überwinden.
Die diskursive Struktur des Beschlusses selbst legte Zeugnis davon ab, dass ihre Zielschreibe, wie schon erwähnt, nicht Achmatova und Zoščenko waren, und ebenso nicht die Redaktionen der in ihm erwähnten Zeitschriften, sondern die ganze sowjetische Kultur als solche und ihre Funktionäre auf der höchsten Ebene, von den Redaktionen der literarisch-künstlerischen Zeitschriften bis zur Verwaltung für Propaganda und Agitation. Gleichzeitig muss erwähnt werden, dass dem Dokument eine gewisse Selbstkritik in dem Sinne eigen war, dass wenn seine Autoren sich auch nicht selbst kritisierten, sie doch die Hauptorgane der staatlichen Kontrolle über die Literatur, Kultur und Ideologie zu Objekten solcher Kritik machten. Als Hauptschuldige dieser Fehlschläge traten Vertreter des sowjetischen kulturellen Establishments auf und besonders sie mussten für die begangenen Fehler bestraft werden. Neben den Leitungen der beiden Zeitschriften waren dies der Vorsitzende des Vorstands des sowjetischen Schriftstellerverbands (SSP), Nikolaj Tichonov, und sogar die Verwaltung für Propaganda des CK der VKP(b), die „nicht die nötige Kontrolle über die Arbeit der Leningrader Zeitschriften sichergestellt hatte“. Auch die Zeitung Lenigradskaja Pravda wurde für die Veröffentlichung einer Rezension von Jurij German über das Werk von Zoščenko bestraft.
Schließlich versetzte der Beschluss vom 14. August 1946 dem Leningrader Stadtkomitee der VKP(b) einen Schlag, indem er seine Vertreter Kapustin und Širokov zu den Schuldigen an den Unzulänglichkeiten der Arbeit der Zeitschriften erklärte. Man muss beachten, worin gerade vom Standpunkt der Autoren des Beschlusses die „groben politischen Fehler“[38] der Leningrader Parteiführung bestanden. Der erste bestand darin, dass das Stadtkomitee „die Fehler der Zeitschriften übersah, sich von der Leitung der Zeitschriften fernhielt und es der sowjetischen Literatur fremden Personen in der Art von Achmatova und Zoščenko ermöglichte, eine leitende Position in den Zeitschriften einzunehmen“. Aber das war nur einer von ihnen. Bedeutend schwerer wog aller Wahrscheinlichkeit nach der zweite, der darin bestand, dass „das Leningrader Stadtkomitee (die Gen. Kapustin und Širokov), obwohl es die Haltung der Partei zu Zoščenko und seinem ‚Werk‘ kannte, ohne das Recht dazu zu haben, mit einem Beschluss des Stadtkomitees vom 28.01. d. J. die neue Zusammensetzung des Redaktionskollegiums der Zeitschrift ‚Zvezda‘, in das auch Zoščenko aufgenommen wurde, bestätigte“. Das war schon eine Überschreitung der Vollmachten des Leningrader Stadtkomitees der VKP(B) als einer gegenüber dem CK als „Haupt und leitende Struktur“ des ganzen politischen Lebens des Landes „untergeordneten Struktur“. Das stellte bereits eine gewisse politische Opposition oder Cliquenwirtschaft dar, die eine strengere Bestrafung erforderte.
„Wie konnte es geschehen, dass die Zeitschriften ‚Zvezda‘ und ‚Leningrad‘, die in Leningrad, der Heldenstadt, herausgegeben werden, die durch ihre fortschrittlichen revolutionären Traditionen bekannt ist, der Stadt, die immer die Keimstätte der fortschrittlichen Ideen und der fortschrittlichen Kultur war, das Einschleppen von der der sowjetischen Literatur fremden politischen Unreife und des Apolitismus in die Zeitschriften zuließen?“, fragten die Autoren des Beschlusses und fanden selbst eine Antwort: Die Ursachen der negativen Erscheinungen in der Literatur müsse man darin suchen, dass ihre Anleitung „vollkommen unbefriedigend“ umgesetzt werde, dass das Leningrader Stadtkomitee der VKP(b) „sich von der Leitung der Zeitschriften fernhielt“, dass „die Verwaltung für Propaganda des CK der VKP(b) nicht die gehörige Kontrolle über die Arbeit der Leningrader Zeitschriften gewährleistete“.
Die Veröffentlichung der Werke von Achmatova und Zoščenko, die ideologischen „Fehler“, die ideologische „Fremdheit“ und um so mehr das niedrige „ästhetische Niveau“, und ebenso Unzulänglichkeiten in der Arbeit der Literaturkritiker, waren ein eher formaler Vorwand für die Schließung der Zeitschrift Leningrad und die strukturellen Veränderungen in der Zeitschrift Zvezda.[39] Gleichzeitig war der wahre Grund für die Kritik an den Zeitschriften, dass ihr Diskurs nicht dem Diskurs der Macht entsprach.
7.
Tatsächlich: Ungeachtet dessen, dass der Beschluss administrative Maßnahmen gegen Schriftsteller und Dichter nach sich zog, die angeblich gegen die politischen, ideologischen und kulturellen Normen des stalinistischen Systems verstießen (die Redaktion der Zvezda, der Vorstand des sowjetischen Schriftstellerverbands und die Verwaltung für Propaganda des CK der VKP(b) wurden verpflichtet, „die Berücksichtigung der Werke von Zoščenko, Achmatova und Konsorten in der Zeitschrift“ „zu beenden“), ging die Hauptstoßrichtung erstens gegen die Zeitschriften und ihre Redaktionen, zweitens gegen die Leitung des Schriftstellerverbands und drittens gegen das Leningrader Stadtkomitee der VKP(b). Die Zeitschrift Leningrad wurde aufgelöst (Pt. 2) und ihrem ehemaligen Chefredakteur ein Verweis erteilt (Pt. 9). In der Zeitschrift Zvezda kam es zu einer Reorganisation der Redaktion: Zu ihrem neuen Chefredakteur wurde unter Beibehaltung seiner früheren Funktion im CK (Pt. 4) der stellvertretende Leiter der UPA des CK der VKP(B), Aleksandr Egolin, ernannt. Diese Umstellungen sollten die Verstärkung der Kontrolle über die Zeitschrift ermöglichen. Aber damit endete die Bestrafung der Schuldigen nicht. Der Leitung des Leningrader Gebietskomitees, und zwar seinem zweiten Sekretär Kapustin, wurde ebenfalls ein Verweis erteilt (Pt. 6). Sein Kollege Širokov wurde vom Amt entbunden (Pt. 7). Jetzt sollten die Leningrader Parteiführer, das Gebietskomitee und der erste Sekretär des Gebietskomitees und des Stadtkomitees, Popkov, die „Parteileitung“ der Zeitschrift Zvezda übernehmen und nicht nur die Arbeit der Zeitschrift selbst verbessern, sondern auch der Leningrader Schriftsteller (Pt. 8). Gleichzeitig wurde der Leitung der UPA des CK der VKP(B) in Person von Aleksandrov die Aufgabe gestellt, „die Erfüllung des vorliegenden Beschlusses (Pt. 11) zu überwachen und Andrej Ždanov wurde zur „Erläuterung“ des Beschlusses nach Leningrad gesandt (Pt. 13).
Die ersten vier Punkte des Beschlusses, die die Zeitschriften betrafen, wurden bekanntgemacht, die übrigen neun, die Maßnahmen auf der Ebene des CK der VKP(b), des Leningrader Stadtkomitees und Gebietskomitees der Partei und ebenfalls der UPA des CK der VKP(b) gewidmet waren, wurden geheim gehalten.[40] Eben deshalb war jahrzehntelang eine kritische Auseinandersetzung mit dem Beschluss in Hinblick auf seine politische Bedeutung unmöglich.
8.
Die Verwirklichung des Beschlusses nahm allmählich den Charakter einer Kampagne an. Schon am folgenden Tag nach seiner Annahme, am 15. August 1946, erfolgte der Bericht Ždanovs in Leningrad und ein Tag später, am 16. August 1946 fand der nächste statt. Die Zuhörer von Ždanov waren die Parteiführer und die Schriftsteller der Stadt. Die Hauptkritik des Berichterstatters war gegen die Leitung der Leningrader Zeitschriften und die Leningrader Schriftsteller selbst gerichtet. Weder die Leningrader Parteiführer noch die Leitung des SSP noch die UPA des CK der VKP(b) wurden in ihm erwähnt. Babičenko sieht darin eine Art Ablenkungsmanöver: Ždanov versuchte angeblich seine Protegés in der Parteiführung Leningrads, die in dem Beschluss kritisiert wurden, zu schützen.[41] Jedoch ist sehr wahrscheinlich, dass Ždanov die Tatsache berücksichtigte, dass die Adressaten seines Berichts in erster Linie Schriftsteller sein würden und es schon in Hinblick auf diesen Umstand für notwendig hielt, auf die entsprechenden Entscheidungen des Beschlusses einzugehen.
In seinem Bericht auf der Schriftstellerversammlung[42] sagte Ždanov nichts Neues über die Werke von Zoščenko und Achmatova. Aber er benutzte andere sprachliche Mittel als im Beschluss. Der Stil seiner Rede überrascht. So drückte sich Ždanov über Zoščenko in einem mit Vulgarismen gesättigten Stil aus, bei dem Gossensprache mitschwang: „Scherzkeks. Seine Werke sind ein Brechmittel. Mit seiner Person betritt ein beschränkter Kleinbürger, ein Spießer die Szene. Die empörende frevelhafte Erzählung ‚Vor dem Sonnenaufgang‘. Dieser Abtrünnige und Missgeburt bestimmt den literarischen Geschmack in Leningrad. Er hat einen Haufen Gönner. Schweinehund, Müllmann, Pack“.[43] Gleichzeitig damit unterstrich er nochmals den „dekadenten Charakter“ der Poesie von Achmatova, indem er bewusst den Inhalt ihrer Werke primitivisierte, wobei er seinen eigenen, äußerst bescheidenen kulturellen Geschmack und sein Niveau offenbarte: „Eine toll gewordene Dame. Das Thema ihrer Poesie: Zwischen dem Boudoir und dem Gebetssaal. Die Poesie der oberen 10.000. Lippen, ja Zähne, Brüste, ja Knies. Schwermut. Einsamkeit. Zoologischer Individualismus. Kunst für die Kunst. Stochern in den Gefühlen. Innere Verwüstung. […] Ihre Poesie ist Ausdruck des Verfalls, des Niedergangs der bourgeoisen und höfischen Kultur. […] Sie vergiftet das Bewusstsein“.[44] Außerdem unterstrich Ždanov noch einmal, dass unter den Leningrader Schriftstellern eine Schwärmerei für die „kleinbürgerliche Literatur des Westens“ vorhanden gewesen sei. Aber was die Bestimmung der Rolle betrifft, die Zoščenko angeblich in dem literarischen Leben Leningrads spielte, so verlor Ždanov hier überhaupt jedes Gefühl für das Maß, wenn er erklärte: „Zoščenko wurde in Leningrad fast eine Koryphäe der Literatur“.
Ždanov schob die Schuld an allem Elend auf die freundschaftlichen Beziehungen, die in den Redaktionen der Zeitschriften existierten, das Fehlen einer kritischen Herangehensweise an die Literatur dort. Dann erinnerte er, wie in dem Beschluss, die Schriftsteller an die Bedeutung der Prinzipien der Parteilichkeit und Volkstümlichkeit in der Literatur und sprach davon, dass „Genosse Stalin unsere Schriftsteller die Ingenieure der menschlichen Seelen“ genannt habe. Was speziell die sowjetische Führung von der Literatur erwartete, formulierte Ždanov direkt, schon ohne jede pseudoideologische Verschleierung: „Wir fordern, dass sie von der Politik geleitet werde“.[45] Im Gegensatz zum Text des Beschlusses stellte Ždanov den Schriftstellern für die Zukunft auch eine allgemeinere Aufgabe und zählte dabei, als Gegengewicht zu den von ihm bisher kritisierten Werk von Zoščenko und Achmatova, die wünschenswerten positiven Eigenschaften der sowjetischen Literatur auf: „Ideologisch und künstlerisch wachsen“, „eine zeitgemäße Thematik“, „bei unseren Menschen die besten Eigenschaften entwickeln“, „Bestätigung und Verherrlichung des Sozialismus“ und ebenso „Qualität“ und „Meisterschaft“ der Werke.[46] Ždanov erklärte kategorisch: „Die Unverantwortlichkeit liquidieren. Man versteht nicht, wer dafür verantwortlich ist“,[47] und meinte damit möglicherweise nicht nur und nicht so sehr die Erhöhung der Verantwortlichkeit jedes Redakteurs für die veröffentlichten Werke, sondern auch eine klare Festlegung der literarisch-politischen Kompetenzen auf dem Niveau der Redaktion literarisch-künstlerischer Zeitschriften zur Überwindung des Chaos in der administrativen Kontrolle und zur Verbesserung deren Zensurarbeit. Möglicherweise zeugen die folgenden zwei Sätze aus dem Bericht Ždanovs davon, dass man „oben“ befürchtete, dass die Deideologisierung der Literatur zur Deideologisierung der Gesellschaft führen konnte: „Ohne Kritik kann man verfaulen. Die Krankheit geht nach innen“.[48] Die auf der Versammlung anwesenden Schriftsteller stimmten in ihrer überwältigenden Mehrheit den Kernaussagen des Berichts von Ždanov zu.[49] Bald darauf wurde der Bericht von Ždanov in der sowjetischen Presse veröffentlicht.[50]
In dieser Zeit kamen reale, administrative und nicht diskursive Repressionen gegen einzelne Personen, die in dem Beschluss erwähnt oder von ihm berührt wurden, in Gang. Zoščenko wurde aus dem Redaktionskollegium der Zvezda entfernt. Zusammen mit Anna Achmatova wurde er aus dem SSP ausgeschlossen und ihnen wurden die Lebensmittelkarten entzogen. Am 27. August 1946 verbot die Hauptverwaltung für die Angelegenheiten der Literatur und Verlage (Glavlit) das Buch von Anna Achmatova „Ausgewählte Gedichte. 1910-1946“. Am selben Tag schreibt Zoščenko einen Brief an Stalin.[51] Da er keine Antwort erhielt, richtete der Schriftsteller am 10. Oktober 1946 noch einen Brief „nach oben“, diesmal schon an Ždanov.[52] Beide Briefe waren im Grunde genommen Versuche des Schriftstellers, die Beschuldigungen, die gegen ihn in dem Beschluss erhoben wurden, zu widerlegen, in erster Linie, die Beschuldigung der „Sowjetfeindlichkeit“. Umstellungen gab es auch in der Leitung des SSP: Aleksandr Fadeev ersetzte Nikolaj Tichonov.
Aber wie lange waren diese Beschränkungen gültig? Denis Babičenko meint, dass schon 1947 eine Änderung des politischen Klimas eintrat. Die Arbeiten von Michail Zoščenko begannen, in Novyj Mir gedruckt zu werden, er erhielt die Lebensmittelkarten zurück. Nikolaj Tichonov wurde Stellvertreter des Generalsekretärs des SSP, Aleksandr Fadeev. Jedoch blieb, wie Babičenko meint, die Abneigung Stalins gegen die „Leningrader“ erhalten.[53]
9.
Jedoch waren damit die Repressionen nicht zu Ende. Eine Welle regelmäßiger Säuberungen rollte über die Redaktionen der Zeitschriften hinweg. Überall suchte man im Land nach dem Vorbild Leningrads unzuverlässige Literaten, die eigenen örtlichen „Achmatovas“ und „Zoščenkos“. Und hier und da wurden Parteiversammlungen (vor allem der Vertreter der Kultur) veranstaltet, wo der Beschluss vom 14. August 1946 und die Berichte von Ždanov erörtert wurden. Die einen Teilnehmer traten mit einer Billigung dieses Kurses auf, die anderen mit einer entlarvenden „Selbstkritik“. Nicht nur die Vertreter der „Sowjetgeneration“, sondern auch Vertreter der russischen Intelligenz mit vorrevolutionärer Vergangenheit, wie die Schauspielerin Aleksandra Jabločkina, schämten sich nicht, die neue offizielle Direktive und Ždanov selbst lobzupreisen. Während der Regisseur Ivan Pyr`ev den Bericht Ždanovs eine „wahrhaftige wissenschaftliche Dissertation“[54] nannte, erklärte Jabločkina, als sie Ždanov Lob zollte: „Genosse Ždanov formulierte unsere gemeinsamen Gedanken und Gefühle“.[55] Ein anderes Beispiel ist die Sitzung des Präsidiums des SSP (unter Beteiligung der Mitglieder der Führung) vom 31. August 1946.[56] Hier bekannte Tichonov alle Sünden und mit ihm noch einige andere Schriftsteller.
Es ist jedoch zu berücksichtigen, mit was sich gerade einige sowjetische Kulturschaffende solidarisierten. Wenn man den erhaltenen fragmentarischen Zeugnissen über ihre Auftritte folgt, so erweist sich, dass sie in erster Linie nicht die Angriffe auf Zoščenko und Achmatova begrüßten, nicht die zum Überdruss werdenden Aufforderungen zur Parteilichkeit, Volkstümlichkeit und der erzieherischen Funktion der Literatur und nicht die Verstärkung der Kontrolle über die Literatur. Die Unterstützung der Kulturschaffenden fand, dass der Beschluss, wie ihnen schien, Schriftstellern und Literaturkritikern in einer Situation der Unbestimmtheit der formal-inhaltlichen Anforderungen an sie von Seiten der offiziellen Organe zur Lenkung der Literatur und Kultur klare Orientierungen gab. Er versetzte, wie es ihnen schien, der Leitung der für die Kultur verantwortlichen Behörden einen Schlag und musste die in ihrem Urteil nicht vorhersagbare Literaturkritik, für deren unverdiente Opfer sich in diesen Jahren viele Schriftsteller hielten, „kriminalisieren“. Gleichzeitig wurde auf absurde Weise der Aufruf zu verstärkter objektiver Kritik künstlerischer Werke befolgt, die unter den Bedingungen der „lackierten Prosa“ kaum ermuntert wurde. Die Kulturschaffenden konnten kaum ihren Protest gegen die Hinweise Ždanovs auf die Notwendigkeit, Werke zu aktuellen Themen zu schaffen oder, beispielsweise darüber, dass er Rechnungen mit der literarischen Dekadenz oder den „Serapionsbürdern“, (deren Mitglied seinerzeit Zoščenko gewesen war) beglich, ausdrücken.
So konnten die Schriftsteller die offiziellen Maßnahmen unterstützen, sogar, ohne in Konflikt mit dem eigenen Gewissen zu geraten und, mehr noch, die eigenen beruflichen und politischen Aufgaben lösen.[57] Im schriftstellerischen Milieu befanden sich auch solche, die vollkommen klar realisierten, dass der Beschluss und die Berichte nicht nur und nicht so sehr gegen Zoščenko und Achmatova und auch die Redaktionen der Zeitschriften gerichtet waren, sondern dass sie eine breitere, über den Rahmen der Kultur hinausgehende ideologische und politische Bedeutung hatten, dass sie auf die Disziplinierung der Gesellschaft abzielten. Die Zeitschriften veröffentlichten rege entlarvende Artikel.[58] Für einen bedeutenden Teil der sowjetischen Schriftsteller diente der Beschluss als Signal für die Notwendigkeit des Schaffens ideologisch und ästhetisch korrekter Werke im Geist des sowjetischen Patriotismus und Heroismus, mit einer entschieden ausgeprägten antiwestlichen Haltung in Übereinstimmung mit den Normen des sozialistischen Realismus.
Jedoch wäre es falsch anzunehmen, dass der Beschluss auch tatsächlich von allen Kulturschaffenden vorbehaltlos angenommen wurde.[59] Das spricht dafür, dass selbst in der stalinistischen Periode ihre sogenannte einmütige Zustimmung zu den Entscheidungen der Parteiführung in Fragen der Kultur eher der öffentliche Diskurs, als Ausdruck ihrer wahren Haltungen, Ansichten und Überzeugungen war. Nach dem Zeugnis von Vadim Koževnikov, dem Redakteur des Literaturteils der Pravda, wurde der Beschluss vom 14. August 1946 von einigen Schriftstellern in privaten Gesprächen als „Kampagne der massenhaften Züchtigung“ betrachtet.[60] Manche von ihnen waren noch mehr als früher ratlos über den Charakter der offiziellen Forderungen. Es gab aber auch solche, wie Sergej Michalkov, der sich selbst auf der Sitzung des Präsidiums des SSP vom 31. August 1946 nicht fürchtete, sich in der Öffentlichkeit über das Talent Anna Achmatovas zu äußern.[61]
Am 26. August dieses Jahres folgte der Beschluss „Über das Repertoire der Schauspielhäuser und Maßnahmen zu seiner Verbesserung“ und eine Woche später, am 4. September, der Beschluss „Über den Kinofilm ‚Das große Leben‘“, der auch Beschuldigungen gegenüber anderen Filmen enthielt, darunter auch gegen „Iwan der Schreckliche“ (2. Folge) von Sergej Ejsenštejn. Andere Maßnahmen, die man im Kontext der Kulturpolitik dieser Zeit betrachten muss, sind die Beschlüsse „Über die Oper ‚Die große Freundschaft‘ von V. Muradeli“ vom 10. Februar 1948, über die Zeitschrift „Krokodil“ vom 5. September 1948 und der Beschluss über die Zeitschrift Znamja vom 11. Januar 1949. Im letzteren wurde die niedrige Qualität der literarischen Produktion, die von der Zeitschrift herausgegeben wurde, erwähnt. Wie im Fall der Zeitschriften Zvezda und Leningrad, waren eines der Hauptziele Repressionen gegen „Schriftstellercliquen“, die sich um ihre Redaktion gebildet hatten. Schließlich fand im Dezember 1948 das Plenum des SSP der UdSSR statt, auf dem als eine der Hauptaufgaben der Schriftsteller, wie anderer Kulturschaffender auch, der Kampf mit dem „Kosmopolitismus“, dem „Formalismus“ und „Ästhetizismus“ erklärt wurde. Der Höhepunkt der Nachkriegspolitik des sowjetischen Patriotismus, gegen „die Kriecherei vor dem bourgeoisen Westen“ wurde die Kampagne zum Kampf mit dem Kosmopolitismus im Jahr 1949, in deren Verlauf das Feindbild teilweise auch „jüdische“ Züge annahm. Mit anderen Worten, es ergab sich eine weitere Bestätigung des antikosmopolitischen Diskurses, der in dem Beschluss „Über die Zeitschriften ‚Zvezda‘ und Leningrad‘“ wiedergegeben wurde.
10.
Der Beschluss „Über die Zeitschriften ‚Zvezda‘ und ‚Leningrad‘“ wurde zum Symbol der Absage an die frühere Kulturpolitik und legte den Grundstein für die sogenannte „Ždanovščina“ in der sowjetischen Kultur, einer Periode der ideologischen „Eindeutigkeit“ und „Unduldsamkeit“, eines harten Kurses der Partei und des Staates gegenüber den Kulturschaffenden, eines „ideologischen und kulturpolitischen Terrors“. In langfristiger Perspektive und in Verbindung mit den anderen Beschlüssen dieser Periode bewirkte er die Verankerung der ideologischen und ästhetischen Prinzipien und „der institutionellen Regeln des sowjetischen Kultursystems“[62], die endgültige Formierung des Systems der ideologischen und politischen Kontrolle über die sowjetische Kultur und Literatur, ihre Isolation von den globalen kulturellen Prozessen, die in den Ländern Westeuropas und den USA abliefen und ebenso das Auftauchen von Werken der Literatur und Kunst, die „farblos“ waren in ästhetischer Beziehung, aber ideologisch „konsequent“ im Geist des sowjetischen Patriotismus und „Antikosmopolitismus“. Die Kultur sollte nun dem Lobpreis des „sowjetischen Übermenschen“ dienen und dem Nachkriegsaufbau im Land des Sozialismus.
11.
In der Periode nach dem Tod Stalins (1953) und besonders nach dem XX. Parteitag (1956) unternahmen Literatur- und Kunstschaffende wiederholte, aber leider ergebnislose Versuche, die Aufhebung des Beschlusses „Über die Zeitschriften ‚Zvezda‘ und ‚Leningrad‘“ vom 14. August 1946 zu erreichen. Er wurde erst in der Periode der Perestroika mit dem neuen Beschluss des CK der KPdSU „Über den Beschluss des CK der VKP(b) ‚Über die Zeitschriften ‚Zvedzda‘ und ‚Leningrad‘‘‘ vom 14. August 1946“ vom 20. Oktober 1988 aufgehoben.[63]
- ↑ In der Sowjetunion gängige Bezeichnung für den Zweiten Weltkrieg, Anm. d. Übers.
- ↑ E. A. Dobrenko, Metafora vlasti: literatura stalinskoj ėpochi v istoričeskom osveščenii. Otto Sagner, München 1993, S. 315, 300, 306.
- ↑ Vgl. Hans Günther, Der sozialistische Übermensch: M. Gor’kij und der sowjetische Heldenmythos. J.B. Metzler, Stuttgart 1993; Katerina Clark, The Soviet Novel: History as Ritual. Univ. of Chicago Press, Chicago London 1981.
- ↑ Günther, op. cit., S. 7.
- ↑ Siehe Dobrenko, op.cit., S. 281, 292, 374.
- ↑ Russische Vereinigung Proletarischer Schriftsteller, Anm. d. Übers.
- ↑ Günther, op. cit.
- ↑ Siehe Leonid V. Maksimenkov, Sumbur vmesto muzyki: stalinskaja kul’turnaja revoljucija 1936 - 1938. Juridičeskaja kniga, Moskva 1997.
- ↑ Victor Erlich, Russischer Formalismus. Suhrkamp, Frankfurt a. M. 1973; Aage A. Hansen-Löve, Der russische Formalismus: Methodologische Rekonstruktion seiner Entwicklung aus dem Prinzip der Verfremdung. 2. Aufl, Österr. Akad. d. Wiss, Wien 1996.
- ↑ Siehe Denis L. Babičenko/Lazarʹ I. Lazarev, Pisateli i cenzory: sovetskaja literatura 1940-ch godov pod političeskim kontrolem CK [Schriftsteller und Zensoren: Die sowjetische Literatur der 1940er Jahre unter der politischen Kontrolle des CK]. Rossija Molodaja, Moskva 1994, S. 30, 37, 50, 56-65.
- ↑ Ebd., S. 72.
- ↑ Ebd., S. 56-57.
- ↑ Ebd., S. 105-106.
- ↑ Ebd., S. 72, 105.
- ↑ Ebd., S. 75-76.
- ↑ Ebd., S. 72-106.
- ↑ Siehe am Beispiel des Beschlusses des Sekretariats des CK der VKP(B), „Über die Kontrolle über literarisch-künstlerische Zeitschriften“ vom 2. Dezember 1943, zit. nach Babičenko, op. cit., S. 90.
- ↑ Ebd., S. 104.
- ↑ Ebd., S. 104.
- ↑ Ein russisches, im Deutschen nicht adäquat wiederzugebendes Wortspiel, Anm. d. Übers.
- ↑ Babičenko, op. cit.,S. 114-116.
- ↑ Ebd., S. 119-120, und ebenso S. 140, 143.
- ↑ Ebd., S. 18.
- ↑ Ebd., S. 46-49.
- ↑ Ebd., S. 46.
- ↑ Ebd., S. 104.
- ↑ Ebd., S. 105.
- ↑ Ebd., S. 116.
- ↑ Ebd., S. 121-124.
- ↑ Über diese Sitzung siehe ausführlich: Ebd., S. 124-133.
- ↑ Ebd., S. 122.
- ↑ Ebd., S. 129.
- ↑ Ebd., S. 131.
- ↑ Ebd., S. 129.
- ↑ Ebd., S. 132. Der Text ist veröffentlicht in: Denis L. Babičenko (Hrsg.), „Literaturnyj front“: istorija političeskoj cenzury, 1932-1946 gg.: Sbornik dokumentov. Ėnciklopedija rossijskich derevenʹ, Moskva 1994, S. 215-218.
- ↑ Sowjetische Künstlervereinigung, der Name wurde dem Titel einer Sammlung von Novellen entlehnt, die E. T. A. Hoffmann 1819-1821 veröffentlichte, Anm. d. Übers.
- ↑ Über die Hierarchisierung des institutionellen Systems der sowjetischen Kultur am Beispiel der Kunst: Galina A. Jankovskaja, Iskusstvo, denʹgi i politika: chudožnik v gody pozdnego stalinizma. Permskij gos. universitet, Permʹ 2007.
- ↑ Siehe Babičenko, Pisateli i cenzory, op. cit., S. 133.
- ↑ Ebd., S. 140.
- ↑ Ebd., S. 135.
- ↑ Ebd., S. 133.
- ↑ Siehe Pravda Nr. 225 vom 21. September 1946, S. 2-3.
- ↑ Babičenko, Literaturnyj front, op.cit., S. 227.
- ↑ Ebd., S. 227-228.
- ↑ Ebd., S. 228.
- ↑ Ebd., S. 229.
- ↑ Ebd.
- ↑ Ebd.
- ↑ Babičenko, Pisateli i cenzory, op. cit., S. 137.
- ↑ Babičenko, Literaturnyj front, op. cit., S. 229.
- ↑ Ebd. S. 230-232.
- ↑ Babičenko, Pisateli i cenzory, op. cit., S. 138-139.
- ↑ Ebd., S. 141-142.
- ↑ Babičenko, Literaturnyj front, op. cit., S. 242.
- ↑ Ebd., S. 241.
- ↑ Babičenko, Pisateli i cenzory, op. cit., S. 137-138.
- ↑ Siehe zur Reaktion der Schriftsteller auf den Beschluss auch: Natalʹja A. Gromova, Raspad. Sud`ba sovetskogo kritika. 40-50-e gody. Ėllis Lak, Moskva 2009, S. 91-102.
- ↑ Babičenko, Pisateli i cenzory, op. cit., S., 136.
- ↑ Siehe die dokumentarischen Zeugnisse: Babičenko, Literaturnyj front, op. cit., S. 242, 251.
- ↑ Ebd., S. 242.
- ↑ Babičenko, Pisateli i cenzory, op. cit., S. 138.
- ↑ Jankovskaja, op. cit.
- ↑ Babičenko, Pisateli i cenzory, op. cit., S., 4.
1.
Постановлению Оргбюро ЦК ВКП(б) «О журналах „Звезда“ и „Ленинград“» от 14 августа 1946 г. предшествовал долгий период корректировки идеологических ориентиров сталинского режима, создание нового, патриотического дискурса. Начиная с 1934 г., в контексте великодержавной имперской внешней политики, ожидаемой угрозы со стороны так называемых империалистических держав (в первую очередь национал-социалистической Германии), построения социализма в одной стране, установления сталинистской однопартийной диктатуры и утверждения культа личности, форсированной индустриализации и коллективизации сельского хозяйства Советское государство перешло от интернационализма к советскому патриотизму как идеологии общественной консолидации, интеграции и мобилизации. Её целью было упрочить власть Сталина, воспитать новую советскую идентичность и способствовать росту лояльности граждан по отношению к советскому государству. Помимо террора, это означало создание второго, культурного столпа режима.
Патриотический перелом нашел отражение как в самовосприятии руководителей этого государства, так и в идентичности его граждан. Новая идеология – своего рода сталинский вариант имперской идеи – распространялась путем официальной пропаганды, а также в рамках системы сталинской культуры, образования и науки, включая официальную историографию. По своему характеру она представляла собой государственный патриотизм. В отличие от пролетарского интернационализма, в этой идеологии центральное место занимали уже не «класс», «диктатура пролетариата и беднейшего крестьянства», «мировая революция» и «международная республика рабочих», а русская «нация» – позже «советский народ», «Отечество» («Родина»), советское государство и партия в лице ее вождя Сталина. Лояльный советский гражданин, образ которого конструировался в патриотическом дискурсе, был связан с государством, как на сознательном, так и на эмоциональном уровне. Комплекс норм, регулирующих его мышление и поведение, предполагал не только безграничную веру и любовь к отечеству, но и готовность к самопожертвованию. Тем самым новая идеология апеллировала к национальной идентичности русских, к их национальному чувству, одновременно дополняя ее новыми, советскими элементами.
Тогда же, одновременно с утверждением советского патриотизма, началась – поначалу в скрытой форме – критика «космополитизма» как его антипода, был создан образ врага в лице «буржуазного Запада». В противоположность советскому патриотизму референтным объектом «космополитизма» была, если следовать советской пропаганде, «Европа», «зарубежные страны» и «весь мир». В годы Великой Отечественной войны советский патриотизм получил свое окончательное оформление. Узурпировав тему войны, названной Великой Отечественной, он после победы Советского Союза над гитлеровской Германией лишь укрепился, а пропагандируемые в рамках советского патриотизма ценности должны были окончательно превратиться в ментальные и поведенческие нормы советского общества. Напротив, «космополитизм» теперь воспринимался как анти-норма. В литературоведении он проявлялся через компаратистику, межлитературные содержальные и формальные связи, в частности, в форме т.н. «бродячих сюжетов», в ущерб патриотическому, национальному подходу к культуре, утверждавшей ее самостоятельность и национальное своеобразие. В литературе проявлением патриотизма стал принцип народности, органически вписавшийся в социалистический реализм, официальную доктрину литературы и искусства. Тем самым, согласно Евгению Добренко, сформировалась одна из «идеологических парадигм» ждановщины, в контексте которой не в последнюю очередь следует рассматривать Постановление Оргбюро ЦК ВКП(б) «О журналах „Звезда“ и „Ленинград“» от 14 августа 1946 г[1].
2.
Патриотический дискурс был лишь одним из дискурсов, конструировавших идентичность советского человека в сталинском обществе. Другим был дискурс о «социалистическом сверхчеловеке»[2] (Гюнтер). Ведь коммунизм был не только политическим и общественным, но и цивилизационным и антропологическим проектом. Ганс Гюнтер в свое время говорил о герое как о «ядре советской мифологии», о героическом как об «обязательной составной части всякой тоталитарной культуры», возникшем в качестве «коллективного продукта», созданного этим коллективом с помощью системы общественной коммуникации, включая науку и образование, социальные практики, дискурсы и метадискурсы[3]. Хотя концепция «социалистического сверхчеловека» создавалась, по меньшей мере, в течение трех десятилетий, собственно «героическая эпоха» советской культуры, политическими лоббистами которой были советские партийные и государственные функционеры, а ее протагонистами отдельные представители советского культурного истэблишмента, началась в конце 1920-ых гг.
Именно герой был призван стать воплощением «высшего общественно-биологического типа», который должен был, по мысли того же Льва Троцкого, появиться на стадии социалистического общества. Именно герою в качестве идеала советского гражданина отводилась воспитательная, социально-педагогическая функция. Именно он был призван мобилизовать гражданина для исполнения политических и общественных задач, которые ставили перед ним партия и государство. По мере утверждения доктрины советского патриотизма этот герой приобретал национальные черты, становясь, в частности, «русским национальным героем»[4]. Начиная с 1930-ых гг. публичный дискурс был проникнут духом героического. Началась институализация героического. Несмотря на противодействие левых групп в искусстве и литературе, например, Левого фронта искусств (ЛЕФ), а также пролетарских групп из окружения РАППа, герой был канонизирован в искусстве социалистического реализма.
В советском дискурсе у героя должен был быть антипод. Таким образом, героическому противопославлялись «декадентство», «упадничество» и «индивидуализм»; они изгонялись в царство буржуазного, капиталистического общества. Противоположностью «социалистического сверхчеловека» стал не только «маленький человек», но и «декадент»: бездеятельный, избыточно склонный к рефлексии и сомнениям, подверженный настроению «упадничества» и «пессимизма». Декадентство, заявившее о себе в России в 1890-ые гг., было одним из течений в литературе и искусстве эпохи модерна. Если в литературной среде XIX века это понятие (также: декаданс) имело изначально положительную коннотацию, то литературные критики отвергали его с большей или меньшей категоричностью. В свою очередь, для искусства и литературы эпохи социалистического реализма писатели-декаденты и герои их произведений стали врагами – «эстетическими» и «содержательными чужими».[5]
3.
Критика в адрес писателей и поэтов, для которых в приоритете была эстетическая функция литературы и искусства, а не этическая и общественно-политическая, и которых художественная форма произведения волновала больше содержания, нашла свое продолжение в дискуссии о т.н. формализме[6]. Как и декадентство, формализм – «формальное направление» или «формальная школа» – изначально являлся самостоятельным направлением, но не в литературе и искусстве, а в литературоведении и языкознании[7]. Зарождение формализма восходит к ОПОЯЗу – Обществу изучения поэтического языка или обществом изучения теории поэтического языка (1916-1925), куда входили, например, Виктор Шкловский, Борис Эйхенбаум, Юрий Тынянов, Роман Якобсон, Осип Брик.
Уже в 1920-ые гг. формализм превратился в одну из излюбленных мишеней близких к советской власти представителей культуры и не в последнюю очередь чиновников. Примером может служить раздел «Формальная школа поэзии и марксизм» в книге Льва Троцкого «Литература и революция» (1923 г.). Своего апогея борьба против формализма, как и борьба с декадентством достигла в ходе политических кампаний 1936-1937 гг., в ходе которых произошло окончательное утверждение героических ценностей в сталинском обществе и социалистического реализма в во всех направлениях советского искусства.
Кампания проводилась под лозунгом борьбы против формализма, «декадентского экспериментализма» и «эстетицизма». По мнению многих представителей сталинского культурного истэблишмента, результатом интереса к формальной стороне произведения была недооценка его идеологических сообщений и политико-воспитательной функции. Как и декадентство, формализм считался символом литературного, а кроме того, и идеологического нонконформизма. В итоге, к формализму были причислены те течения в литературе и искусстве, эстетика которых не соответствовала принципам социалистического реализма, т.е. яркие проявления культуры модерна дореволюционного периода; в изобразительном искусстве – от символизма до футуризма и абстракционизма. Авторы соответствующих произведений обвинялись в том, что их работы стоят на «антинародных позициях», а народность была одним из принципов социалистического реализма, а также в том, что они нарушают принцип реализма и естественности языка, впав в формализм, а кроме того еще и в натурализм, что рассматривалось как проявление мелкобуржуазности в искусстве и приравнивалось к аполитизму.
Начало кампании было положено в статье «Сумбур вместо музыки. Об опере „Леди Макбет Мценского уезда“», появившейся в «Правде» 28 января 1936 г. В ней эти обвинения впервые были выражены в концентрированном виде. С целью легитимации кампании с помощью авторитета прижизненного классика социалистического реализма Максима Горького, «Правда» 9 апреля 1936 г. печатает его статью «О формализме». В 1937 г., журнал «Звезда» перепечатал антидекадентскую статью того же Горького «Поль Верлен и декаденты» (1896), впервые опубликованную на рубеже XIX и XX вв. Формы преследования неугодных деятелей культуры были самими разными – от нападок в прессе до административных мер и бойкота творчества. Жертвами кампании стали писатели, художники, композиторы и режиссеры. Преследованиям подверглись, в частности, композитор Дмитрий Шостакович, театральный режиссер Всеволод Мейерхольд и кинорежиссер Сергей Эйзенштейн. Со временем понятие формализм утратило свою связь с действительными представителями «формального направления», смысл его изменился, в нем стали обвинять всех писателей и деятелей искусства, уделявших большое внимание вопросам художественной формы.
4.
Большинство авторов, исследующих историю советской культуры в сталинский период, рассматривают постановление «О журналах „Звезда“ и „Ленинград“» в контексте культурной политики коммунистической партии и советского государства.
Начиная с конца 1920-ых годов ВКП(б) начала претендовать на определяющую роль в советском искусстве. Одновременно был запущен процесс идеологического, эстетического и институционального огосударствления культуры, и, в частности, литературы. Была создана система прямого и косвенного контроля за представителями искусства. Ее основными элементами были многоуровневая система цензуры, Союз советских писателей (ССП), созданный в 1932 г. после роспуска отдельных писательских объединений, централизованная система издательства и дистрибуции культурной и литературной продукции и воспитание «культурных кадров». Контроль осуществлялся с помощью идеологических кампаний (например, против формализма в 1936 г.), предоставления лояльным деятелям культуры материальных привилегий и статусных наград (какой была, например, учрежденная в 1940 г. Сталинская премия), вмешательства в процесс создания литературных произведений, запрета одних и поддержка других авторов – то есть, при помощи поощрений и запретов.
Искусство и литература рассматривались в качестве инструмента политики для легитимации советской власти и формирования идентичности советского гражданина и общества. Иными словами, культура стала средством «социального инжениринга» (social engineering). Каждый деятель культуры был, по словам самого Сталина, «инженером человеческих душ». Советская культура, все ее субъекты и институты должны были выполнять социальный заказ. Перед ними ставились задачи по воспитанию общества, их интересы должны были совпадать с интересами партии и государства, то есть, с интересами их руководства, говорящих от имени всего советского народа.
Социалистический реализм был официально объявлен основополагающей (эстетической) доктриной советской культуры. Одним из последствий стало преследование «декадентской литературы» и «декадентской поэзии», а также обвинения авторов в формализме. Уже в предвоенный период результатом такой политики стало падение содержательного и эстетического уровня советских произведений. Деятели культуры, с точки зрения сталинского культурного официоза отступившие от утвержденных им содержательных и формальных норм, стали жертвами рестрикций, а в годы Большого террора они пострадали и в качестве предполагаемых сторонников политической оппозиции.
5.
Спустя год после окончания Великой Отечественной войны у руководства партии и правительства, по-видимому, сложилось впечатление, что значимость советских ценностей и норм, равно как и их влияние на культуру и степень ее огосударствления ослабла, а, значит, ослабла и власть партии над обществом. Обращаясь к общественному восприятию культурной политики военного периода, можно сделать вывод о том, что в в этот сложный период произошла её либерализация, в то время как для периода, непосредственно предшествовавшего началу войны были характерны жесткие меры по утверждению власти партии и государства в сфере культуры[8].
Год спустя после войны поэт Николай Тихонов говорил, что в частности, в 1941-1942 гг. писатели жили довольно хорошо, особенно если сравнивать эти годы со вторым периодом войны[9]. Это мнение отражает распространённое представление о том, что в годы Великой Отечественной войны партия, государство и общество слились в едином патриотическом порыве, так что деятели литературы и искусства не воспринимали существующие дисциплинарные и рестриктивные рамки как серьёзные ограничения. В действительности, руководство СССР в первый период войны, примерно до зимы 1942/43 гг., сосредоточилось на военной мобилизации и консолидации страны, и, вероятно, перед лицом более важных организационных задач военного периода покинуло идеологическое и административное поле культуры и пошло по пути культурно-политических «концессий», лишь незначительно вмешиваясь в культурную жизнь и отказавшись от административных мер и публичного осуждения провинившихся[10].
Однако органы цензуры по-прежнему делали свою работу. В тех случаях, когда литература и искусство не выдерживали испытание официальными идеологическими и эстетическими нормами, они бескомпромиссно вмешивались в культурный процесс. Это вмешательство происходило, в основном, на «среднем» и «низшем уровне». C коренного перелома в войне после битвы под Сталинградом началась постепенная «ревизия» этой т. н. либерализации на «высшем уровне» и утверждение прежней «гегемонии» партии и государства в области культуры. В частности, это выражалось через нападки на того же Михаила Зощенко из-за его книги «Перед восходом солнца» (1943). Однако до момента, когда эта политика примет радикальные формы, было еще далеко.
Независимо от того, имела ли место такая сознательная либерализация культурной политики, в период войны деятели культуры стали более критично оценивать советскую действительность. В это время появились произведения, едва ли вписывающиеся в официальную линию, в интеллигентской среде выросли надежды на реформу сталинской общественно-политической системы после установления мира. Кроме того, опыт Великой Отечественной войны стал для многих граждан СССР опытом межкультурных взаимодействий, в зоне которого оказались не только Третий рейх, под оккупацией и идеологическим влиянием которого в годы войны оказались огромные и стратегически важные территории европейской части страны, но и мировоззренчески враждебные СССР западные государства, среди них – союзники по Антигитлеровской коалиции. Большевики видели опасность в том, что «тело» советской культуры оказалось якобы «заражено» «вирусом» чужой идеологии, а общество, а вместе с ним и культура попали под влияние вражеского дискурса и покинули позицию советского (или русского) патриотизма. Через призму критики советская действительность могла оказаться далеко не столь идеальной, какой ее рисовал сталинский дискурс. Как следствие, возникла опасность распространения оппозиционных настроений, что повлекло бы за собой разрушение консенсуса между партией, государством и обществом.
Это ощущение надвигающейся опасности подкреплялось появлением нового мышления у советского человека, прошедшего войну – человека мужественного, с бойцовскими качествами, полного решимости отстаивать свои интересы. Кроме того, хотя советское общество, окрыленное победой в конце войны, и было полно воли к жизни, однако оно устало от материальных и физических лишений последних четырех лет и явно стремилось к передышке от трудностей и избавлению от чрезмерной опеки со стороны государства и его карательных органов.
Однако с точки зрения государства такая ситуация в культуре и обществе была неприемлема в силу ряда внутри- и внешнеполитических обстоятельств. К внутриполитическим относят экономическое возрождение Советского Союза, его промышленности и сельского хозяйства после войны, которое требовало от советских граждан новых жертв.
Другим фактором, сыгравшим свою роль в предыстории принятия Постановления от 14 августа 1946 г., стала внешнеполитическая обстановка, в частности, начало «холодной войны», распад антигитлеровской коалиции, обострение отношений между Западом и Востоком, между США и СССР. Перед Советским Союзом стояла задача сохранить своё влияние в мире, ценой больших усилий завоеванное в годы Великой Отечественной войны. Идеал «социалистического сверхчеловека» – патриота, преданного Советскому Союзу, русскому народу в качестве «несущей» опоры советского общества, коммунистической партии и ее вождю Иосифу Сталину – стал более актуальным. «Космополит», «пессимист» и «эстет» – таков был образ врага, черты которого, как уже было замечено выше, начали оформляться ещё в предвоенный период. Теперь этот образ получил свою завершенность. Если «космополит» ставил под сомнение превосходство СССР над Западом и Америкой во всех областях политической, экономической, социальной и культурной жизни, подвергая сомнению «национальную самостоятельность» и «национальное своеобразие» русской культуры, ее отличность от западной, то «эстет» был повинен в чрезмерном увлечении художественной формой произведения в ущерб его – в первую очередь идеологическому – содержанию. Среди представителей как первой, так и второй группы доминировали деятели советской культуры еврейского происхождения.
В связи с этим руководству партии и государства казалось важным еще раз обратить внимание общества на ценности и нормы советской системы, подвергнуть ревизии прежний «либеральный курс» и закрутить гайки для того, чтобы укрепить идентичность советского гражданина и исключить возможность его идентификации с враждебным Западом, а также дисциплинировать культуру, вернув ее на путь выполнения социального заказа. Наконец, Постановление было своеобразным порывом советской системы утвердить приоритет партии и государства над отдельными лицами, укрепить его направляющую и контролирующую роль в борьбе против неформальных объединений различных деятелей или «кланов», сложившихся вокруг литературных журналов и имевших своих «крестных отцов» среди представителей высшей партийной и государственной номенклатуры. В этом документ стал очередным этапом борьбы Сталина и его окружения за власть, апогеем которого станут такие сфабрикованные правительством процессы, как «Ленинградское дело», дело Еврейского антифашистского комитета или «Дело врачей».
В 1990-ые гг. российский исследователь Денис Бабиченко вновь обратился к изучению обстоятельств появления и политическому замыслу постановления «О журналах „Звезда“ и „Ленинград“». Основываясь на документах Российского государственного архива социально-политической истории (РГАСПИ) он пришел к выводу, что историю появления этого документа и его цели следует рассматривать в контексте политической истории второй половины 1940-ых гг., а именно во властно-политическом контексте и конексте соперничества ленинградской и московской группировки в их борьбе за приоритетные позиции в государстве[11]. Принимая это во внимание, он объясняет не только время создания документа, но и тот факт, что козлами отпущения были выбраны именно ленинградские журналы, а также поэтесса и писатель Анна Ахматова и Михаил Зощенко, считавшиеся «лениградцами».
Ссылаясь на те статьи Постановления от 14 августа, где речь шла об обвинениях в адрес ленинградского партийного руководства, которое якобы совершило грубую политическую ошибку и упустило из виду ошибки журналов, а также обращая внимание на отсутствие такой критики в адрес партийных инстанций в других постановлениях о культуре в этот период, и на то, что в обвинительных материалах по «Ленинградскому делу» имели место ссылки на «Дело о журналах» 1946 г., Бабиченко приходить к выводу, что Постановление от 14 августа 1946 г. нанесло один из первых ударов по ленинградскому партийному руководству, а само оно стало своего рода преддверием «Ленинградского дела».
Главным действующим лицом этого «удара по Ленинграду» стал Георгий Маленков. Еще недавно бывший одним из влиятельнейших представителей советской партийной верхушки, он попал в опалу Сталина, в частности, в связи с делом против Главного маршала авиации А. Новикова и наркома авиапромышленности А. Шахурина. Маленков как их непосредственный куратор в ЦК партии потерял свой пост секретаря и начальника управления кадрами ЦК ВКП(б). Опала Маленкова означала возвышение «ленинградцев», в первую очередь Жданова и Кузнецова, занявших ряд крупных постов в партийном руководстве, в т.ч. посты самого Маленкова. Однако тот скоро был реабилитирован и решил отомстить «ленинградцам», подвергнув критике и нападкам их работу в различных областях, в том числе и в культуре.
Однако едва ли следует рассматривать данное Постановление как один из шагов по планомерной подготовке этой крупной политической аферы. Интеграция «Дела о журналах» в последующее «Ленинградское дело» произошла скорее всего задним числом, а не планировалась заранее как его составная часть. Такая практика была вполне в духе сталинского режима. Кроме того, может показаться странным, что на публике в качестве главного протагониста всей аферы, направленной против ленинградских партийных руководителей, выступил Андрей Жданов, лоббист «лениградцев» в высших эшелонах власти. Следовал ли он только своему партийному и служебному долгу? Если судить по воспоминаниям свидетелей этих событий, то, возможно, это было именно так.
Однако тот же Бабиченко не отрицает, что данное Постановление имело культурно-политическую направленность. Так, он рассматривает его в контексте общего ужесточения советской культурной политики, начиная с 1943 года[12]. Таким образом, Постановление Оргбюро ЦК ВКП(б) «О журналах „Звезда“ и „Ленинград“» от 14 августа 1946 г. представляется одной из таких мер, в частности, наряду с Постановлением Секретариата ЦК о рассказе Алексея Каплера «Письма лейтенанта Л. Из Сталинграда» от 15 декабря 1942 г., в котором автор обвинялся в «антихудожественности» и «надуманности» в изображения действующих лиц, или с запретом на публикацию произведений Александра Довженко с последующем снятием его со всех занимаемых должностей из-за его киноповести «Победа» и сценария «Украина в огне», которое якобы было выдержано в духе «украинского национализма» (1943/1944), а также многими другими подобными мерами[13].
К похожим мерам можно отнести и ряд постановлений о литературных журналах, служивших для установления контроля над публицистикой и художественной литературой в советском обществе, среди них постановления «О контроле над литературно-художественными журналами» (отменено в 1946 г.), «О повышении ответственности секретарей литературно-художественных журналов» (оба – декабрь 1943 г.), «О журнале «Знамя» (1944 г.), принятых на уровне ЦК ВКП(б)[14]. По официальным оценкам, критическая ситуация в сфере культуры стала с 1943-1944 гг. темой многочисленных совещаний на высшем уровне – как правило в рамках УПА ЦК ВКП(б). Примечательно однако, что объектом нападок в данных случаях были не только сами деятели советской культуры, и такие её институты, как издательства и большие литературно-художественные журналы – то есть практически все уровни литературного и культурного процесса, – но и административные институты советской идеологии и культуры и их представители – Управление пропаганды и агитации ЦК ВКП(б) и секретари издательств и журналов[15].
Постановление от 14 августа 1946 г. во многом повторяло идеологические и политические обвинения и аргументы аналогичных более ранних и поздних документов. Их авторы также обвиняли своих жертв в «серьезных недостатках», «политических ошибках», «политическом вредительстве», «антихудожественности», «формализме», «искажении образа советского человека» или «советской действительности», «преклонении перед Америкой»[16]. Наконец, они обвинялись в таком опасном действии, как «выдвижение буржуазной идеи свободы творчества»[17]. Если жертвами «словесной чистки» становились функционеры советской культуры, то литературно-художественными журналам выдвигались дополнительные обвинения, важнейшим из которых был «слабый контроль» за культурой и литературой, а также отсутствие «должного идейного и литературно-художественного уровня».
За этими мерами, мероприятиями и высказываниями скрывалось, по всей видимости, опасение руководителей партии и государства потерять влияние не только на культуру, но и на общественное сознание, что было чревато утратой контроля за ситуацией. Эти опасения, кажется, находили подтверждение в агентурных сводках МГБ, в которых особый упор делался на «политически неблагонадежные настроения и высказывания писателей» (причем даже таких, которые в целом проявляли свою лояльность по отношению к сталинскому режиму), их недовольство редакционной политикой издательств и журналов, а также цензурой, которая заметно усилилась в первый год после войны. Открытым выражением такого недовольства стала статья писателя Федора Панферова «О черепах и черепушках», напечатанная в журнале «Октябрь» в 1946 г., в которой критиковалось отношение цензоров и литературных критиков к литературе[18].
В свою очередь, причину того, что на роль козлов отпущения в данном случае были выбраны ленинградские журналы «Звезда» и «Ленинград», а также писатели Анна Ахматова и Михаил Зощенко, следует искать также в ситуации с этими журналами на данный момент и в творческой судьбе поэтессы и писателя в рамках советской системы культуры[19]. Тем не менее, не следует упускать из внимания тот факт, что «Звезду» критиковали уже в Постановлении Оргбюро «О редакциях литературно-художественных журналов» от 20 августа 1939 г.[20], а за год до принятия Постановления от 14 августа 1946 г. журнал критиковали публикацию «пессимистических» стихотворений ряда советских поэтов. Т.е. «ленинградский участок» считался по идеологическим и административным причинам одним из слабых в области советского журнального дела.
По словам Бабиченко, в контексте тех же политических обстоятельств следует объяснять и выбор Анны Ахматовой и Михаила Зощенко на роль главных обвиняемых. Сама Ахматова хотя и не относилась к числу обласканных властью советских литераторов, однако в период, непосредственно предшествующий принятию Постановления, преследованиям не подвергалась. Решительные меры против нее были приняты в 1940 г., когда «при посредничестве» Жданова был изъят из обращения уже опубликованный сборник ее стихов «Из шести книг»[21]. В частности, Ахматову тогда обвиняли в том, что в ее произведениях отсутствует революционная тематика и «советская тематика о людях социализма»[22]. Однако позже ее стихи снова стали публиковать в литературно-художественных журналах, а книги включались в издательские планы крупных столичных издательств[23].
Похожая судьба постигла и Михаила Зощенко. В годы войны он подвергался критике со стороны представителей советского культурного истэблишмента за свой роман «Перед восходом солнца». Однако в июне 1946 г. Зощенко стал членом редколлегии журнала «Звезда»; здесь же публиковались его произведения, тот самый рассказ «Приключения обезьяны», ставший одним из доказательств «вины» писателя, действительно обличавшего в этом произведении «советского мещанина» и тем самым опосредованно ставившего под сомнение воспитательную функцию советской системы, ее усилия по созданию советского «нового человека». Даже за месяц до выхода Постановления в партийной прессе Ленинграда можно было найти положительные оценки творчества писателя[24]. Тот факт, что выбор пал именно на Ахматову и Зощенко, лишь частично объясняется формой и содержанием их творчества, а также его оценкой «сверху». Возможно, что другое объяснение следует искать в факте их «ленинградского» происхождения, который сыграл роковую роль, принимая во внимание «антиленинградскую» направленность самого Постановления.
Обратимся к событиям, непосредственно предшествовавшим появлению Постановления от 14 августа 1946 г. Одним из них является совещание у Жданова 18 апреля 1946 г., посвященное вопросам пропаганды и агитации[25]. Этому заседанию Бабиченко придает ключевое значение в подготовке Постановления, определении его жертв (и, возможно, исполнителей). Основными темами были, в частности, состояние советской литературы и руководство ею. Выступавшие, в т.ч. Жданов, отмечали «недостаточно» высокий уровень художественных произведений, а также «недостаточность» работы представителей ведомств по делам культуры, Управления пропаганды и агитации и литературных критиков как основных институтов для борьбы с «толстыми журналами» и нелояльными писателями. В качестве негативного примера были названы журналы «Новый мир» и «Звезда». По сути, на этом собрании были приняты к сведению соображения, высказанные Сталиным за несколько дней до этого, 13 апреля 1946 г., на заседании Политбюро ЦК ВКП(б). По словам Жданова, сам генсек тоже был весьма недоволен именно двумя названными выше журналами. Подводя итоги заседания, Жданов заключил, что выполняя соответствующее требование Сталина, следует усовершенствовать руководство советской литературой, в частности, усовершенствовать работу Управления пропаганды и агитации, отвечавшего за литературную критику. Он также намекнул на то, что, возможно, следует сократить число выпускаемых журналов. Однако сразу после этого не было предпринято никаких конкретных действий.
Бюрократическая машина управления советской культуры заработала вновь только спустя три месяца. В докладной записке Александрова и Еголина на имя Жданова от 7 августа 1946 г. речь шла, исходя из её названия, непосредственно о «неудовлетворительном состоянии журналов „Звезда“ и „Ленинград“». Авторы документа предлагали реорганизацию редколлегии «Звезды» и ликвидацию «Ленинграда»[26]. К записке прилагался проект соответствующего Постановления ЦК.
Дальнейшие события развивались по следующему сценарию. 9 августа проходило заседание Оргбюро ЦК ВКП(б), на котором присутствовал Сталин, Маленков и первый секретарь ленинградского горкома ВКП(б) Попков[27]. Одним из обсуждавшихся вопросов была ситуация с журналами «Звезда» и «Ленинград». Как в докладной записке Александрова и Еголина,[28] так и на заседании Оргбюро ЦК ВКП(б) объектом критики стали Анна Ахматова и Михаил Зощенко, а кроме них и ряд других писателей, публиковавшихся в этих журналах. Если первую обвиняли в «упаднических настроениях в творчестве», незначительности ее поэтического творчества (об этом шла речь в выступлении самого Сталина), то претензии к Зощенко заключались в том, что он якобы «с издёвкой» описывал «трудности жизни нашего народа в дни войны» и представлял советских людей «очень примитивными» и «ограниченными», «оглуплял» их.
При этом сам вождь, как считает Бабиченко, проявил удивительное незнание творчества этого писателя. Когда же речь зашла о самих ленинградских «толстых журналах», то его оценка их деятельности была, по справедливому замечанию исследователя, такой же негативной, как и оценка деятельности соответствующих московских органов. Примечателен тот факт, что первоначально в проекте Постановления речь не шла об отдельных руководителях ленинградской партийной организации. Среди подвергнутых критике административных органов были УПА ЦК ВКП(б) и Отдел Пропаганды Ленинградского горкома ВКП(б)[29]. Но на заседании Оргбюро ситуация уже была иной. В то время как изначально «антиленинградская» позиция Сталина не была очевидной, она несомненно присутствовала у Маленкова. Именно он возложил вину за недостатки в работе ленинградских журналов на весь Ленинградский городской комитет ВКП(б) и способствовал превращению дела ленинградских журналов ещё и в дело ленинградских партийных руководителей[30].
Примечательно, что ленинградских партийных лидеров уже тогда обвинили не только в низком художественном уровне местных журналов и плохом руководстве ими, но и в том, что они уронили авторитет партийного и государственного руководства в Москве, не согласовывая с ним свою журнальную политику. Характерна была реакция Жданова, который, как только представился случай, выразил свою поддержку присутствовавшим на заседании Оргбюро ленинградским партийным руководителям. В это время сами «ленинградцы» не выступали единым фронтом. Например, Попков в своем выступлении, встал не на сторону ленинградских писателей, а, наоборот, пытался обвинить во всем их одних[31]. В конце концов, под давлением Сталина и Маленкова, он все же вынужден был выступить с критикой своей работы и признать собственные ошибки. В самокритике упражнялись и руководители обоих ленинградских журналов. Что касается реакции писателей, приглашенных на Оргбюро, то судя по протоколу заседания, негативные доводы, в частности против Ахматовой, были для определенной части из них недостаточно убедительными. Напротив, творчество той же Ахматовой представлялось им вполне отвечавшим ценностям «советского человека».
Хотя в оформление окончательного варианта текста Постановления помимо Жданова внесли свою лепту и другие люди, период в культурной политике СССР, начало которому заложило Постановление от 14 августа 1946 г., получил название «ждановщины», ведь опубликованные и ставшие широко известными официальные доклады, разъяснявшие смысл этого Постановления, были подготовлены именно им. Уже в преддверии принятия Постановления в дело включились органы МГБ, что уже само по себе свидетельствовало о том, что партия всерьёз взялась за литературу и культуру. Именно ими было составлено досье на Зощенко, содержавшее утверждение об «антисоветском» характере всей его творческой деятельности, которое 10 августа 1946 г. было направлено секретарю ЦК ВКП(б) Алексею Кузнецову[32]. 14 августа 1946 г. Постановление было принято на заседании Оргбюро.
6.
Следуя сталинскому дискурсу, Постановление начиналось с перечисления проблем – в данном случае идеологической безыдейности и просчётов редакции журналов, также объяснялись причины ошибок и назывались виновные. Затем были перечислены меры, направленные на устранение недостатков и наказание провинившихся. Ахматова и Зощенко были интересны авторам документа не сами по себе, а как аллегории на «чужих» или «врагов» сталинского государства и общества. Представление об обоих литераторах в тексте Постановления было сконструировано в соответствии с образом «чужого»/«врага» эпохи позднего сталинизма: «антипатриота», «космополита», «декадента» и «эстета».
Так, Зощенко в Постановлении был назван «пошляком» и «подонком» – в рассказе «Приключение обезьяны» он якобы представил «пошлый пасквиль на советский быт и на советских людей», изобразил «советские порядки и советских людей в уродливо карикатурной форме, клеветнически представляя советских людей примитивными, малокультурными, глупыми, с обывательскими вкусами и нравами», а его « хулиганское изображение» «нашей действительности» сопровождалось «антисоветскими выпадами». Преступления Ахматовой, «литературная и общественно-политическая физиономия которой», как утверждалось в Постановлении, «давным-давно известна советской общественности», были иного рода. Из текста следовало, что «Ахматова является типичной представительницей чуждой нашему народу пустой безыдейной поэзии. Ее стихотворения, пропитанные духом пессимизма и упадочничества, выражающие вкусы старой салонной поэзии, застывшей на позициях буржуазно-аристократического эстетства и декадентства, „искусстве для искусства“, не желающей идти в ногу со своим народом наносят вред делу воспитания нашей молодежи и не могут быть терпимы в советской литературе». Писатель и поэтесса обвинялись в «безыдейности» и «аполитичности», последняя к тому же – в «чуждости народу». Примечательно, что «квазиформалистские» обвинения прозвучали в Постановлении скорее в адрес Ахматовой, а не Зощенко, который в 1920-ые гг. был связан с «Серапионовыми братьями», членом которых был формалист Виктор Шкловский; с легкой руки литературных критиков Зощенко одно время даже относили к формалистам.
Аналогичные обвинения, разбавленные указаниями на факты «низпоклонства перед современной буржуазной культурой Запада», «низкопоклонства по отношению ко всему иностранному» (т.е. в сущности «космополитизма») и на то, что поэтесса обратилась к темам «тоски», «пессимизма», «разочарования в жизни», выдвигались и против ряда других авторов, печатавшихся в обоих журналах, как и против этих журналов как таковых. В такой острой и концентрированной форме обвинения в отсутствии патриотизма или «космополитизме» в официальном советском документе появились впервые. При этом обвинения идеологического и этического характера явно преобладали над обвинениями относительно эстетики произведений. Тем самым Зощенко и Ахматовой ставилась в вину недостаточная приверженность названным ранее официально утвержденным ценностям и нормам патриотизма, героизма, соцреализма и политизации литературы. На примере обвиняемых подчеркивалось расхождение между их индивидуальным дискурсом и дискурсом власти и – именно в этом заключалась основная мысль этих пассажей Постановления – выдвигалось требование строго следовать этим ценностям и нормам.
Однако объектом официальной критики были не только и не столько произведения Ахматовой и Зощенко, сколько сам факт их публикации. В свою очередь, став трибуной для работ этих двоих, журналы «Звезда» и «Ленинград», их руководство в лице главных редакторов В. М. Саянова («Звезда») и Д. С. Лихарева («Ленинград») также нарушили принцип партийности советской культуры, предполагавший ориентацию на политические интересы сталинской партии и государства, на властной дискурс, принцип «литературы как политики». Ведь они забыли, что советские журналы «не могут быть аполитичными», что они «должны руководствоваться тем, что составляет жизненную основу советского строя – его политикой».
Также в Постановлении было отмечено, что определяющей силой литературного и культурного процесса является народ, выразителем мнения и интересов которого были те же партия и государство. Следовательно, журналы и их руководство противопоставили интересам партии и народа интересы отдельных групп («приятельские», «личные» отношения), не входящих во систему власти и партийную иерархию. Тем самым они – сродни литературным группам конца 1920-ых гг. – впали в «групповщину» и поставили под вопрос саму систему – власть партийного и государственного руководства[33]. Именно в этом и заключалось плохое руководство литературно-художественными журналами «Звезда» и «Ленинград», представленное в Постановлении как «либерализм» и «серьезные политические ошибки». Указывая редакциям журналов на их вину, авторы документа, в конечном счете, стремились восстановить ранее утвержденное соотношение сил между советским государством, культурой и обществом.
Постановление не оставляло сомнений на тот счет, в чем состояла одна из главных опасностей таких произведений и такой публикационной политики журналов – в их «дезориентирующем влиянии на молодежь», в «отравлении их сознания», «нанесении вреда делу воспитания» советской молодежи. Оно настойчиво напоминало своим адресатам о воспитательной функции советских журналов, и тем самым о воспитательной функции всей советской культуры. Ведь перед журналами ставилась задача воспитать советскую молодежь в духе героических ценностей – воспитать новое поколение бодрым, верящим в свое дело, готовым преодолеть все препятствия.
Сама дискурсивная структура Постановления свидетельствовала о том, что его мишенью были, как уже было отмечено, не Ахматова и Зощенко, и даже не редакции названных в нем журналов, а вся советская культура как таковая, и ее функционеры высшего звена – от редакций литературно-художественных журналов до Управления пропаганды и агитации. В то же время, следует отметить, что документу была присуща определенная самокритичность в том смысле, что его авторы хотя и не критиковали самих себя, но сделали объектами такой критики главные органы государственного контроля за литературой, культурой и идеологией. В качестве основных виновников этих провалов выступали представители советского культурного истэблишмента, и именно их следовало наказать за допущенные ошибки. Помимо руководства обоих журналов это были председатель Правления Союза советских писателей (ССП) Николай Тихонов и даже Управление пропаганды ЦК ВКП(б), которое «не обеспечило надлежащего контроля за работой ленинградских журналов». Досталось и газете «Ленинградская правда» за публикацию рецензии Юрия Германа о творчестве Зощенко.
Наконец, Постановление от 14 августа 1946 г. ударило по Ленинградскому городскому комитету ВКП(б), назначив виновными в недостатках работы журналов его представителей Капустина и Широкова. Следует обратить внимание на то, в чем именно с точки зрения авторов Постановления состояли «грубые политические ошибки»[34] Ленинградского партийного руководства. Первая заключалась в том, что горком «проглядел ошибки журналов, устранился от руководства журналами и предоставил чуждым советской литературе людям, вроде Ахматовой и Зощенко, занять руководящее положение в журналах». Но это была только одна из них. Гораздо более тяжелой была, по всей вероятности, вторая, которая состояла в том, что «зная отношение партии к Зощенко и его „творчеству“, Ленинградский горком (тт. Капустин и Широков), не имея на то права, утвердил решением горкома от 28.I. с.г. новый состав редколлегии журнала „Звезда“, в который был введен и Зощенко». Это было уже превышением полномочий Ленинградского горкома ВКП(б) как «подчиненной структуры» по отношению к ЦК как «главной и направляющей структуры» всей политической жизни страны. Это была уже некая политическая оппозиция или групповщина, требовавшая более строгого наказания.
«Как могло случиться, что журналы „Звезда“ и „Ленинград“, издающиеся в Ленинграде, городе-герое, известном своими передовыми революционными традициями, городе, всегда являвшемся рассадником передовых идей и передовой культуры, допустили протаскивание в журналы чуждой советской литературе безыдейности и аполитичности?», – спрашивали авторы Постановления и сами же находили ответ: причины негативных явлений в литературе следует искать в том, что руководство ими осуществлялось «совершенно неудовлетворительно», что Ленинградский горком ВКП(б) «устранился от руководства журналами», что «Управление пропаганды ЦК ВКП(б) не обеспечило надлежащего контроля за работой ленинградских журналов».
Публикацию произведений Ахматовой и Зощенко, идейные «ошибки», идейную «чуждость» и тем более низкий «эстетический уровень», а также недостатки в работе литературных критиков следует считать скорее формальным поводом для закрытия журнала «Ленинград» и структурных изменений в журнале «Звезда»[35]. В то же время истинной причиной для критики журналов было несоответствие их дискурса властному дискурсу.
7.
Действительно: Несмотря на то, что Постановление повлекло за собой административные меры против писателей и поэтов, якобы преступивших политические, идеологические и культурные нормы сталинской системы (редакции «Звезды», Правлению Союза советских писателей и Управлению пропаганды ЦК ВКП(б) вменялось «прекратить» «доступ в журнал произведений Зощенко, Ахматовой и им подобных»), основное направление удара пришлось, во-первых, на журналы и их редакции, во-вторых, на руководство Союза писателей, в-третьих – на Ленинградский горком ВКП(б). Журнал «Ленинград» был ликвидирован (п. 2), а его бывшему главному редактору, был объявлен выговор (п. 9). В журнале «Звезда» произошла реорганизация редакции: его новым главным редактором с сохранением своей прежней должности в ЦК (п. 4) был назначен заместитель начальника УПА ЦК ВКП(б) Александр Еголин. Эти перестановки должны были способствовать укреплению контроля за журналом. Но на этом наказания провинившихся не закончились. Руководству Ленинградского обкома, а именно его второму секретарю Капустину, был также объявлен выговор (п. 6). Его коллега Широков был освобожден от должности (п. 7). Теперь ленинградские партийные руководители – обком и первый секретарь обкома и горкома Попков – должны были взять на себя «партруководство» журналом «Звезда» и улучшить работу не только самого журнала, но и ленинградских писателей (п. 8). Одновременно перед руководством УПА ЦК ВКП(б) в лице Александрова ставилась задача следить «за выполнением настоящего постановления» (п. 11), а Андрей Жданов был отправлен в Ленинград для «разъяснения» Постановления (п. 13).
Первые четыре пункта Постановления, касавшиеся самих журналов, подлежали огласке, остальные девять, посвященные мерам на уровне ЦК ВКП(б), Лениградского горкома и обкома партии, а также УПА ЦК ВКП(б), были засекречены[36]. Именно поэтому в течение десятилетий критическое осмысление Постановления с учетом его политического значения было невозможно.
8.
Проведение Постановления в жизнь постепенно приобрело характер кампании. Уже на следующий день после его принятия, 15 августа 1946 г., последовал доклад Жданова в Ленинграде, а днем позже, 16 августа 1946 г., состоялся следующий. Слушателями Жданова были партийные руководители и писатели города. Основная критика докладчика была направлена против руководства ленинградских журналов и самих ленинградских писателей. Ни ленинградские партийные руководители, ни руководство ССП, ни УПА ЦК ВКП(б) в нем не упоминались. Бабиченко видит в этом своего рода отвлекающий маневр: Жданов якобы пытался защитить своих подопечных в партийном руководстве Ленинграда, которые критиковались в Постановлении[37]. Однако, вполне вероятно, что Жданов учёл тот факт, что адресатами его доклада будут в первую очередь писатели, и уже в силу этого обстоятельства счел нужным остановится на соответствующих решениях Постановления.
В своём докладе на собрании писателей[38] Жданов не сказал ничего нового о произведениях Зощенко и Ахматовой. Но он использовал другие языковые средства, чем в Постановлении. Стиль его речи поражает. Так о Зощенко Жданов высказался в насыщенном вульгаризмами стиле, от которого веяло площадной бранью: «Пошляк. Его произведения – рвотный порошок. В его лице на арену выходит ограниченный мелкий буржуа, мещанин. Возмутительная хулиганская повесть „Перед восходом солнца“. Этот отщепенец и выродок диктует литературные вкусы в Ленинграде. У него рой покровителей. Пакостник, мусорщик, слякоть»[39]. Одновременно с этим, он еще раз подчеркнул «декадентский характер» поэзии Ахматовой, сознательно примитивизируя содержание ее произведений, обнажая при этом собственный, весьма скромный культурный вкус и уровень: «Взбесившаяся барыня. Тематика ее поэзии – между будуаром и моленной. Поэзия верхних 10.000. Губы, да зубы, груди, да колени. Тоска. Одиночество. Зоологический индивидуализм. Искусство для искусства. Ковыряние в своих эмоциях. Внутреннее опустошение. [...] Ее поэзия – выражение упадка, заката буржуазной и дворянской культуры. [...] Отравляет сознание»[40]. Кроме того, Жданов еще раз подчеркнул, что среди ленинградских писателей присутствовало увлечение «мещанско-буржуазной литературой Запада». Но что касается определения той роли, которую Зощенко якобы играл в литературной жизни Ленинграда, то здесь Жданов вообще потерял всякое чувство меры, заявив: «Зощенко в Ленинграде стал чуть-ли не корифеем литературы».
Во всех бедах Жданов обвинял приятельские отношения, существовавшие в редакциях журналов, отсутствие там критического подхода к литературе. Затем он, как и в Постановлении, в категорической форме напомнил писателям о значимости принципов партийности и народности литературы, говоря о том, что «товарищ Сталин назвал наших писателей инженерами человеческих душ». Что именно советское руководство ожидало от литературы, Жданов сформулировал напрямую, уже безо всякой псевдоидейной завуалированности: «Мы требуем, чтобы руководствовались политикой»[41]. На контрасте с текстом Постановления Жданов ставил перед писателями на будущее и более общую задачу, перечисляя при этом – в противовес критикуемому им до этого творчеству Зощенко и Ахматовой – желаемые положительные качества советской литературы: «Расти идейно и художественно», «современная тематика», «развивать у наших людей лучшие качества», «утверждение и воспевание социализма», а также «качество» и «мастерство» произведений[42]. Жданов категорически заявлял: «Ликвидировать безответственность. Не поймешь, кто отвечает»[43], возможно имея тем самым ввиду не только и не столько повышение ответственности каждого редактора за публикуемые произведения, но и четкое определение литературно-политических компетенций на уровне редакций литературно-художественных журналов в целях преодоления административно-контрольного хаоса и улучшения их цензурной деятельности. Возможно, что следующие два предложения из ждановского доклада свидетельствуют о том, что «наверху» опасались, что деидеологизации литературы приведет к деидеологизации общества: «Без критики можно загнить. Болезнь пойдет внутрь»[44]. Присутствовавшие на собрании писатели в подавляющем большинстве согласились с основными положениями доклада Жданова[45]. Вскоре ждановский доклад был опубликован в советской прессе[46].
Тем временем набирали силу реальные, административные, не дискурсивные репрессии против отдельных лиц, упомянутых или затронутых Постановлением. Зощенко уволили из состава редколлегии «Звезды». Вместе с Анной Ахматовой он был исключен из ССП и лишен продовольственных карточек. 27 августа 1946 г. Главлит запретил книгу Анны Ахматовой «Избранные стихи. 1910-1946». В тот же день Зощенко пишет Сталину письмо[47]. Не получив ответа, писатель 10 октября 1946 г. направляет еще одно письмо «наверх» – теперь уже Жданову[48]. Оба письма были, по сути дела, попыткой писателя опровергнуть обвинения, предъявленные ему в Постановлении – в первую очередь, обвинение в «антисоветчине». Перестановки произошли и в руководстве ССП – Николая Тихонова сменил Александр Фадеев.
Но как долго действовали эти ограничения? Денис Бабиченко считает, что уже в 1947 г. произошло изменение политического климата. Работы Михаила Зощенко начали печатать в «Новом мире», он получил обратно продовольственные карточки. Николай Тихонов стал заместителем Генерального секретаря ССП Александра Фадеева. Однако, как считает Бабиченко, неприязнь Сталина к «ленинградцам» сохранилась[49].
9.
Однако на этом репрессии не закончились. Волна очередных чисток прокатилась по редакциям журналов. Повсюду в стране по примеру Ленинграда искали неблагонадежных литераторов, своих местных «Ахматовых» и «Зощенко». И тут и там проводились партийные собрания (прежде всего представителей культуры), где обсуждались Постановление от 14 августа 1946 г. и доклады Жданова. Одни участники выступали с одобрением этого курса, другие же – с разоблачительной «самокритикой». Не только представители «советского поколения», но и такие представители русской интеллигенции с дореволюционным прошлым, как актриса Александра Яблочкина, не стеснялись славословить в адрес новой официальной директивы и самого Жданова. Если режиссер Иван Пырьев назвал ждановский доклад «подлинной научной диссертацией»[50], то Яблочкина, воздавая хвалу Жданову, заявила: «Товарищ Жданов сформулировал наши общие мысли и чувства»[51]. Другой пример – заседание Президиума ССП (при участии членов правления) 31 августа 1946 г[52]. Здесь во всех грехах покаялся Тихонов, а вместе с ним и некоторые другие писатели.
Следует, однако, обратить внимание на тот факт, с чем именно солидаризовались некоторые деятели советской культуры. Если следовать сохранившимся фрагментарным сведениям об их выступлениях, оказывается, что они приветствовали в первую очередь не нападки на Зощенко и Ахматову, не набившее оскомину напоминание о партийности, народности и воспитательной функции литературы, не усиление контроля за литературой. Поддержку деятелей культуры находило то, что Постановление, как им казалось, давало четкие ориентиры для писателей и литературных критиков в ситуации неопределенности формально-содержательных требований к ним со стороны официальных органов руководства литературой и культурой. Оно, как им представлялось, наносило удар по руководству отвечавших за культуру ведомств, и должно было «приструнить» непредсказуемую в ее приговорах литературную критику, незаслуженными жертвами которой в те годы себя считали многие писатели. Одновременно с этим абсурдным образом прослеживался призыв к усилению объективной критики художественных произведений, которая в условиях существования «лакировочной прозы» едва ли поощрялась. Вряд ли деятели культуры могли выразить протест против указания Жданова на необходимость создавать произведения на современные темы или, например, того, что он сводил счеты с литературным декадентством и «Серапионовыми братьями», членом которых в свое время был Зощенко.
Таким образом, писатели могли поддержать официальные меры, даже не вступая в конфликт с собственной совестью, и более того, решая собственные профессиональные и политические задачи[53]. В писательской среде находились те, кто совершенно четко осознавал, что Постановление и доклады направлены не только и не столько против Зощенко и Ахматовой, а также редакций журналов, но имеют более широкое, выходящее за рамки культуры, идеологическое и политическое значение, что они нацелены на дисциплинирование общества. Журналы активно публиковали разоблачительные статьи[54]. Для значительной части советских писателей Постановление послужило сигналом о необходимости создания идеологически и эстетически правильных произведений в духе советского патриотизма и героизма, с явно выраженной антизападной позицией, в соответствии с нормами социалистического реализма.
Однако было бы ошибочным полагать, что Постановление и в самом деле было безоговорочно принято всеми деятелями культуры[55]. Это говорит о том, что даже в сталинский период их так называемое единодушное согласие с решениями партийного руководства по вопросам культуры было скорее публичным дискурсом, чем отражением их истинной позиции, взглядов и убеждений. По свидетельству Вадима Кожевникова, редактора литературного отдела «Правды», Постановление от 14 августа 1946 г. рассматривалось некоторыми писателями в приватных разговорах как «кампания массовой порки»[56]. Некоторые из них еще больше, чем ранее, недоумевали по поводу характера официальных требований. Но были и такие, как Сергей Михалков, который даже на заседании Президиума ССП 31 августа 1946 г. не побоялся в открытую высказаться о таланте Анны Ахматовой[57].
26 августа того же года последовало Постановление «О репертуаре драматических театров и мерах по его улучшению», а спустя неделю, 4 сентября, – Постановление «О кинофильме „Большая жизнь“», содержавшее также обвинения в адрес других фильмов, в том числе против «Ивана Грозного» (2 серия) Сергея Эйзенштейна. Другими мерами, которые следует рассматривать в контексте культурной политики этого времени, были Постановление «Об опере „Великая дружба“ В. Мурадели» от 10 февраля 1948 г., о журнале «Крокодил» от 5 сентября 1948 г. и Постановление о журнале «Знамя» от 11 января 1949 г. В последнем из них отмечалось низкое качество литературной продукции, выпускаемой журналом. Как и в случае с журналами «Звезда» и «Ленинград», одной из основных целей были репрессии против писательских «клик», сформировавшихся вокруг его редакции. Наконец, в декабре 1948 г. состоялся пленум ССП СССР, на котором в качестве одной из основных задач писателей, как и других деятелей культуры, объявлялась борьба с «космополитизмом», «формализмом» и «эстетицизмом». Апогеем послевоенной политики советского патриотизма, против «низкопоклонства перед буржуазным Западом» станет кампания по борьбе с космополитизмом 1949 г., в ходе которой образ врага примет зачастую и «еврейские» черты. Другими словами, получит дальнейшее утверждение антикосмополитический дискурс, воспроизведенный в Постановлении «О журналах „Звезда“ и „Ленинград“».
10.
Постановление «О журналах „Звезда“ и „Ленинград“» стало символом отказа от прежней культурной политики и положило начало так называемой «ждановщине» в советской культуре – периоду идеологической «однозначности» и «нетерпимости», жесткого курса партии и государства по отношению к деятелям культуры, «идеологического и культурнополитического террора». В долгосрочной перспективе и в совокупности с другими постановлениями этого периода оно способствовало закреплению идеологических и эстетических принципов и «институциональных правил советской культурной системы»[58], окончательному формированию системы идеологического и политического контроля над советской культурой и литературой, ее изоляции от глобальных культурных процессов, имевших место в странах Западной Европы и США, а также появлению произведений литературы и искусства, «серых» в эстетическом отношении, но идеологически «выдержанных» в духе советского патриотизма и «антикосмополитизма». Культура теперь должна была служить прославлению «советского сверхчеловека» и послевоенного возрождения в стране социализма.
11.
В период после смерти Сталина (1953 г.) и особенно после XX съезда партии (1956 г.) деятели литературы и искусства предпринимали неоднократные, но, к сожалению, безрезультатные попытки добиться отмены постановления «О журналах „Звезда“ и „Ленинград“» от 14 августа 1946 г. Оно было отменено только в период Перестройки новым постановлением ЦК КПСС «О постановлении ЦК ВКП(б) «О журналах „Звезда“ и „Ленинград“ от 14 августа 1946 г.» от 20 октября 1988 г[59].
- ↑ Добренко, Е. А. Метафора власти. Литература сталинской эпохи в историческом освещении. München: Otto Sagner, 1993. С. 315, 300, 306.
- ↑ См.: Günther, H. Der sozialistische Übermensch: M. Gor’kij und der sowjetische Heldenmythos. Stuttgart: J.B. Metzler, 1993; Кларк, К. Советский роман: история как ритуал. Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2002. С. 69-138
- ↑ Günther, ук. соч. С. 7.
- ↑ См.: Добренко, ук. соч. С. 281. 292, 374.
- ↑ Günther, ук. соч.
- ↑ См.: Максименков, Л. В. Сумбур вместо музыки. Сталинская культурная революция 1936-1938. Москва: Юридическая книга, 1997.
- ↑ См.: Эрлих, В. Русский формализм: история и теория. Санкт-Петербург: Академический проект, 1996; Ханзен-Лёве, О. А. Русский формализм. Методологическая реконструкция развития на основе принципа остранения. Москва: Яз. рус. культуры, 2001.
- ↑ См.: Бабиченко, Д. Л., Лазарев, Л. И. Писатели и цензоры. Советская литература 1940-х годов под политическим контролем ЦК. Москва: Россия молодая, 1994. С.30, 37, 50, 56-65.
- ↑ Там же. С. 72.
- ↑ Там же. С. 56-57.
- ↑ Там же. С. 105- 106.
- ↑ Там же. С. 72, 105.
- ↑ Там же. С. 75-76.
- ↑ Там же. С. 72-106.
- ↑ См. на примере Постановления Секретариата ЦК ВКП(б) «О контроле над литературно-художественными журналами» от 2 декабря 1943 г., цит. по: Бабиченко, ук. соч. С. 90.
- ↑ Там же. С. 104.
- ↑ Там же.
- ↑ Там же. С. 114-116.
- ↑ Там же. С. 119-120, а также с. 140, 143.
- ↑ Там же. С. 18.
- ↑ Там же. С. 46-49.
- ↑ Там же. С. 46.
- ↑ Там же. С. 104.
- ↑ Там же. С. 105.
- ↑ Там же. С. 116.
- ↑ Там же. С. 121-124.
- ↑ Об этом заседании подробно см.: Там же. С. 124-133.
- ↑ Там же. С. 122.
- ↑ Там же. С. 129.
- ↑ Там же. С. 131.
- ↑ Там же. С. 129.
- ↑ См.: Там же. С. 132. Текст опубликован в: Литературный фронт. История политической цензуры, 1932-1946 гг.: Сборник документов / под ред. Д. Л. Бабиченко. Москва: Энциклопедия российских деревень, 1994. С. 215-218.
- ↑ О иерархичности институциональной системы советской культуры на примере искусства: Янковская, Г. А. Искусство, деньги и политика: Художник в годы позднего сталинизма: монография. Пермь: Пермский гос. университет, 2007.
- ↑ См.: Бабиченко, Писатели и цензоры, ук. соч. С. 133.
- ↑ Там же. С. 140.
- ↑ Там же. С. 135.
- ↑ Там же. С. 133.
- ↑ См. Правда, № 225, 21 сентября 1946 г., с. 2-3.
- ↑ Бабиченко, Литературный фронт, ук. соч. С. 227.
- ↑ Там же. С. 227-228.
- ↑ Там же. С. 228.
- ↑ Там же. С. 229.
- ↑ Там же..
- ↑ Там же.
- ↑ Бабиченко, Писатели и цензоры, ук. соч. С. 137.
- ↑ Бабиченко, Литературный фронт, ук. соч. С. 229.
- ↑ Там же. С. 230-232.
- ↑ Бабиченко, Писатели и цензоры, ук. соч. С. 138-139.
- ↑ Там же. С. 141-142.
- ↑ Бабиченко, Литературный фронт, ук. соч. С. 242.
- ↑ Там же. С. 241.
- ↑ Бабиченко, Писатели и цензоры, ук. соч. С. 137-138.
- ↑ См. о реакции писателей на Постановление также: Громова, Н. А. Распад. Судьба советского критика. 40-50-е годы. Москва: Эллис Лак, 2009. С. 91-102.
- ↑ Бабиченко, Писатели и цензоры, ук. соч. С. 136.
- ↑ См. документальные свидетельства: Бабиченко, Литературный фронт, ук. соч. С. 242, 251.
- ↑ Там же. С. 242.
- ↑ Бабиченко, Писатели и цензоры, ук. соч. С. 138.
- ↑ Янковская, ук. соч.
- ↑ Бабиченко, Писатели и цензоры, ук. соч. С. 4.
Beschluss des Orgbüros des CK der VKP(B) „Über die Zeitschriften ‚Zvezda‘ und ‚Leningrad‘“ vom 14. August 1946
Nr. 274. P- 1g-Über die Zeitschriften „Zvedza“ und „Leningrad“.
Das CK der VKP(b) bemerkt, dass die in Leningrad herausgegebenen literarisch-künstlerischen Zeitschriften „Zvezda“ und „Leningrad“ vollkommen unzufriedenstellend geleitet werden.
In der Zeitschrift „Zvezda“ erschienen in der letzten Zeit, neben bedeutenden und gelungenen Werken sowjetischer Schriftsteller, viele ideologisch unreife und schädliche Werke.
Ein grober Fehler der „Zvezda“ ist es, dem Schriftsteller Zoščenko, dessen Werke der sowjetischen Literatur fremd sind, ein literarisches Forum zu bieten. Der Redaktion der „Zvezda“ ist es bekannt, dass Zoščenko sich seit langem auf das Verfassen leerer, inhaltsloser und banaler Dinge spezialisiert hat, auf das Predigen verfaulter politischer Unreife, Banalitäten und Apolitismus, die darauf berechnet sind, unsere Jugend zu desorientieren und ihr Bewusstsein zu vergiften. Die letzte von den veröffentlichten Erzählungen Zoščenkos, „Abenteuer eines Affen“ („Zvezda“, Nr. 5-6, 1946), stellt eine geschmacklose Schmähschrift über den sowjetischen Alltag und den sowjetischen Menschen dar. Zoščenko beschreibt das sowjetische System und die sowjetischen Menschen in verzerrter karrikierender Form und schildert die sowjetischen Menschen verleumderisch als primitive, unkultivierte Dummköpfe mit kleinbürgerlichem Geschmack und Moral. Die boshafte flegelhafte Darstellung unserer Wirklichkeit durch Zoščenko wird von antisowjetischen Angriffen begleitet.
Die Bereitstellung der Seiten der „Zvezda“ für einen solchen Scherzkeks und Abschaum der Literatur wie Zoščenko ist um so unzulässiger, als das Antlitz Zoščenkos der Redaktion der „Zvezda“ gut bekannt war und sein würdeloses Verhalten in Kriegszeiten, als Zoščenko dem sowjetischen Volk in nichts in seinem Kampf gegen die deutschen Eroberer half und eine solch ekelhafte Sache wie „Vor dem Sonnenaufgang“ schrieb, deren Einschätzung wie auch die Einschätzung des ganzes literarischen „Schaffens“ von Zoščenko auf den Seiten der Zeitschrift „Bolschewik“ wiedergegeben wurde.
Die Zeitschrift „Zvezda“ popularisiert auch auf jede erdenkliche Weise die Werke der Schriftstellerin Achmatova, deren literarisches und gesellschaftspolitisches Antlitz schon längst der sowjetischen Öffentlichkeit bekannt ist. Achmatova ist die typische Vertreterin einer unserem Volk fremden, leeren, ideenlosen Poesie. Ihre Gedichte, die vom Geist des Pessimismus und der Dekadenz getränkt sind, die den Geschmack der alten Salonpoesie ausdrücken, auf den Positionen des bürgerlich-aristokratischen Naturalismus und der Dekadenz erstarrt sind, ‚einer Kunst für die Kunst‘, da sie nicht wünscht, mit ihrem Volk Schritt zu halten, fügen der Sache der Erziehung unserer Jugend Schaden zu und können in der sowjetischen Literatur nicht geduldet werden.
Dass Zoščenko und Achmatova eine aktive Rolle in der Zeitschrift zur Verfügung gestellt wurde, brachte zweifellos Elemente einer ideologischen Zerfahrenheit und Desorganisation unter die Leningrader Schriftsteller. In der Zeitschrift begannen Werke zu erscheinen, die einen den sowjetischen Menschen fremdartigen Geist der Kriecherei vor der zeitgenössischen bourgeoisen Kultur des Westens kultivierten.
Es wurden Werke publiziert, die von Schwermut, Pessimismus und der Enttäuschung im Leben durchdrungen sind (die Gedichte von Sadof`ev und Komissarova in Nr. 1, 1946 usw.). Indem sie diese Werke platzierte, verschlimmerte die Redaktion ihre Fehler und senkte das ideologische Niveau der Zeitschrift weiter.
Indem sie das Eindringen von im ideologischen Sinne fremden Werken in die Zeitschrift zuließ, senkte die Redaktion auch die Anforderungen an die künstlerische Qualität des gedruckten literarischen Materials.
Die Zeitschrift wurde mit wenig künstlerischen Schauspielen und Erzählungen („Der Weg der Zeit“ von Jagdfel`dt, „Schwanensee“ von Štein usw) gefüllt.
Eine solche Beliebigkeit bei der Auswahl des Materials zum Druck führte zu einer Senkung des künstlerischen Niveaus der Zeitschrift.
Das CK bemerkt, dass die Zeitschrift „Leningrad“ besonders schlecht geführt wird, die beständig ihre Seiten für die banalen und verleumderischen Auftritte Zoščenkos und für die leeren und apolitischen Gedichte Achmatovas zur Verfügung stellte. Wie die Redaktion der „Zvezda“ ließ sich die Redaktion der Zeitschrift „Leningrad“ schwerwiegende Fehler zuschulden kommen, indem sie eine Reihe von Werken veröffentlichte., die vom Geist der Kriecherei vor allem Ausländischen durchdrungen sind. Die Zeitschrift druckte eine Reihe fehlerhafter Werke („Der Vorfall über Berlin“ von Varšavskij und Rest, „Auf Posten“ von Slonimskij). In den Gedichten von Chazin „Die Rückkehr von Onegin“ wird unter dem Mantel der Literaturparodie das zeitgenössische Leningrad verleumdet. In der Zeitschrift „Leningrad“ werden vorranging inhaltslose minderwertige literarische Materialien platziert.
Wie konnte es geschehen, dass die Zeitschriften „Zvezda“ und „Leningrad“, die in Leningrad, der Heldenstadt, herausgegeben werden, die durch ihre fortschrittlichen revolutionären Traditionen bekannt ist, der Stadt, die immer die Keimstätte der fortschrittlichen Ideen und der fortschrittlichen Kultur war, das Einschleppen von der der sowjetischen Literatur fremden politischen Unreife und des Apolitismus in die Zeitschriften zuließen? Was ist der Grund der Fehler der Redaktionen von „Zvezda“ und „Leningrad“? Die leitenden Mitarbeiter der Zeitschriften und in erster Linie ihre Redakteure, die Gen. Sajanov und Licharev, vergaßen den Leitsatz des Leninismus, dass unsere Zeitschriften, ob sie nun wissenschaftliche oder künstlerische seien, nicht unpolitisch sein könnten. Sie vergaßen, dass unsere Zeitschriften ein mächtiges Instrument des sowjetischen Staates bei der Erziehung der sowjetischen Menschen und im Besonderen der Jugend sind und sich deshalb davon leiten lassen müssen, was die Lebensgrundlage der sowjetischen Gesellschaftsordnung darstellt: ihre Politik. Die sowjetische Gesellschaftsordnung kann eine Erziehung der Jugend im Geiste der Gleichgültigkeit gegenüber der sowjetischen Politik, im Geiste der Interesselosigkeit und der ideologischen Unreife nicht dulden.
Die Kraft der sowjetischen Literatur, der fortschrittlichsten Literatur in der Welt, besteht darin, dass sie eine Literatur ist, die keine anderen Interessen hat und auch nicht haben kann außer den Interessen des Volkes, den Interessen des Staates. Die Aufgabe der sowjetischen Literatur besteht darin, dem Staat zu helfen, die Jugend richtig zu erziehen, auf ihre Nachfragen zu antworten, eine neue Generation von lebensfrohen, von ihrer Sache überzeugten, keine Hindernisse Fürchtenden und zur Überwindung jeglicher Hindernisse Bereiten zu erziehen.
Deshalb ist jede Predigt der politischen Unreife, des Apolitismus, „der Kunst für die Kunst“ der sowjetischen Literatur fremd, schädlich für die Interessen des Sowjetvolkes und -staates und darf in unseren Zeitschriften keinen Platz haben.
Der Mangel an politischer Reife der leitenden Mitarbeiter der „Zvezda“ und von „Leningrad“ führte ebenso dazu, dass diese Mitarbeiter nicht die Interessen der richtigen Erziehung des sowjetischen Menschen und die politische Ausrichtung der Tätigkeit der Literaturschaffenden zur Grundlage ihrer Beziehungen mit diesen machten, sondern persönliche, freundschaftliche Interessen. Aus dem Wunsch, die freundschaftlichen Beziehungen nicht zu verderben, wurde die Kritik abgeschwächt.
Aus der Furcht, die Freunde zu beleidigen, wurden klar untaugliche Werke zum Druck zugelassen. Eine solche Art des Liberalismus, bei dem die Interessen des Volkes und des Staates, die Interessen der richtigen Erziehung unserer Jugend den freundschaftlichen Beziehungen zum Opfer gebracht werden und bei dem die Kritik gemildert wird, führt dazu, dass die Schriftsteller aufhören, sich weiterzuentwickeln, das Bewusstsein ihrer Verantwortung vor dem Volk, vor dem Staat und vor der Partei verlieren und aufhören sich nach vorn zu bewegen.
Alles oben Ausgeführte zeugt davon, dass die Redaktionen der Zeitschriften „Zvezda“ und „Leningrad“ nicht mit der übertragenen Aufgabe zurechtgekommen sind und sich ernsthafte politische Fehler bei der Führung der Zeitschriften zuschulden kommen lassen haben.
Das CK stellt fest, dass die Leitung des sowjetischen Schriftstellerverbands und, im Besonderen, sein Vorsitzender Gen. Tichonov keinerlei Maßnahmen zur Berichtigung der Zeitschriften „Zvezda“ und „Leningrad“ unternommen und den Kampf mit dem schädlichen Einfluss von Zoščenko, Achmatova und ihnen ähnlichen unsowjetischen Schriftstellern auf die sowjetische Literatur nicht nur nicht geführt haben, sondern sogar das Eindringen solcher Tendenzen und Gepflogenheiten, die der sowjetischen Literatur fremd sind, in die Zeitschriften begünstigt haben.
Das Leningrader Stadtkomitee der VKP(b) übersah die schwerwiegendsten Fehler der Zeitschriften, zog sich von der Leitung der Zeitschriften zurück und verschaffte den der sowjetischen Literatur fremden Personen wie Zoščenko und Achmatova die Möglichkeit, eine leitende Position in den Zeitschriften einzunehmen. Mehr noch, das Leningrader Stadtkomitee, (die Gen. Kapustin und Širokov), obwohl es die Haltung der Partei zu Zoščenko und seinem „Werk“ kannte, bestätigte, ohne das Recht dazu zu haben, mit einem Beschluss des Stadtkomitees vom 28.01. d.J. die neue Zusammensetzung des Redaktionskollegiums der Zeitschrift „Zvezda“, in das auch Zoščenko aufgenommen wurde. Damit beging das Leningrader Stadtkomitee einen groben politischen Fehler. Die „Leningradskaja Pravda“ hat sich einen Fehler zuschulden kommen lassen, indem sie die verdächtige lobhudelnde Rezension von Jurij German über das Werk Zoščenkos in der Nummer vom 6. Juni d. J. platzierte.
Die Verwaltung für Propaganda des CK der VKP(B) gewährleistete nicht die gebührende Kontrolle über die Arbeit der Leningrader Zeitschriften.
Das CK der VKP(B) beschließt:
1. Die Redaktion der Zeitschrift „Zvedza“, die Leitung des sowjetischen Schriftstellerverbands und die Verwaltung für Propaganda beim CK der VKP(B) zu verpflichten, Maßnahmen zur bedingungslosen Beseitigung der in diesem Beschluss aufgezeigten Fehler und Mängel der Zeitschrift zu ergreifen, die Linie der Zeitschrift zu korrigieren und ein hohes ideologisches und künstlerisches Niveau der Zeitschrift zu gewährleisten und die Berücksichtigung der Werke von Zoščenko, Achmatova und Konsorten in der Zeitschrift zu beenden.
2. Angesichts dessen, dass es in Leningrad zum gegenwärtigen Zeitpunkt für die Herausgabe von zwei literarisch-künstlerischen Zeitschriften nicht die notwendigen Voraussetzungen gibt, die Herausgabe der Zeitschrift „Leningrad“ einzustellen und die literarischen Kräfte von Leningrad um die Zeitschrift „Zvezda“ zu konzentrieren.
3. Zur Einführung der gebührenden Ordnung in der Redaktion der Zeitschrift „Zvezda“ und zur ernsthaften Korrektur des Inhalts der Zeitschrift soll es in der Zeitschrift einen Chefredakteur und bei ihm ein Redaktionskollegium geben. Es ist festzulegen, dass der Chefredakteur der Zeitschrift die volle Verantwortung für die ideologisch-politische Ausrichtung der Zeitschrift und die Qualität der in ihr veröffentlichten Werke trägt.
4. Als Chefredakteur der Zeitschrift „Zvezda“ den Gen. A. M. Egolin zu bestätigen, wobei er das Amt des stellvertretenden Leiters der Verwaltung für Propaganda des CK der VKP(B) behalten soll.
5. Das Sekretariat des CK zu beauftragen, den Bestand der Redakteure der Abteilungen und des Redaktionskollegiums zu prüfen und zu bestätigen.
6. Den Beschluss des Leningrader Stadtkomitees vom 26. Juli d. J. über das Redaktionskollegium der Zeitschrift „Zvezda“ als politisch fehlerhaft aufzuheben. Dem zweiten Sekretär des Stadtkomitees, Gen. Ja. F. Kapustin, für die Annahme dieses Beschlusses einen Verweis zu erteilen.
7. Den Sekretär für Propaganda und Leiter der Abteilung für Propaganda und Agitation des Leningrader Stadtkomitees, Gen. I. M. Širokov, von seiner Arbeit zu entbinden und ihn zur Verfügung des CK der VKP(B) abzuberufen.
8. Dem Leningrader Gebietskomitee die Parteiführung der Zeitschrift „Zvezda“ zu übertragen. Das Leningrader Gebietskomitee und den ersten Sekretär des Leningrader Gebietskomitees und Stadtkomitees, Gen. Popkov, persönlich zu verpflichten alle notwendigen Maßnahmen zur Verbesserung der Zeitschrift und zur Forcierung der ideologisch-politischen Arbeit unter den Schriftstellern Leningrads zu verstärken.
9. Dem Gen. B. M. Licharev für die schlechte Leitung der Zeitschrift „Leningrad“ einen Verweis zu erteilen.
10. Angesichts dessen, dass die Zeitschrift „Zvezda“ mit bedeutender Verspätung erscheint und äußerst achtlos gestaltet ist (der Umschlag bietet ein unansehliches Bild, es wird nicht der Monat der Herausgabe der folgenden Nummer angegeben), die Redaktion der „Zvezda“ zu verpflichten, das rechtzeitige Erscheinen der Zeitschrift zu gewährleisten und ihre äußere Erscheinung zu korrigieren.
11. Der Verwaltung für Propaganda des CK (dem Gen. Aleksandrov) die Kontrolle über die Ausführung dieses Beschlusses zu übertragen.
12. Beim Orgbüro des CK in drei Monaten den Bericht des Chefredakteurs der „Zvezda“ über die Ausführung des Beschlusses des CK anzuhören.
13. Den Gen. Ždanov zur Erklärung des vorliegenden Beschlusses des CK der VKP(B) nach Leningrad zu kommandieren.
RGASPI, f. 17, op. 116, d. 274, l. 7-11, 30. Übersetzung aus dem Russischen: Georg Wurzer.
Постановление Оргбюро ЦК ВКП(б) «О журналах «Звезда» и «Ленинград», 14 августа 1946 г.
№ 274. п. 1г – О журналах «Звезда» и «Ленинград».
ЦК ВКП(б) отмечает, что издающиеся в Ленинграде литературно-художественные журналы «Звезда» и «Ленинград» ведутся совершенно неудовлетворительно.
В журнале «Звезда» за последнее время, наряду со значительными и удачными произведениями советских писателей, появилось много безыдейных, идеологически вредных произведений.
Грубой ошибкой «Звезды» является предоставление литературной трибуны писателю Зощенко, произведения которого чужды советской литературе. Редакции «Звезды» известно, что Зощенко давно специализировался на писании пустых, бессодержательных и пошлых вещей, на проповеди гнилой безыдейности, пошлости и аполитичности, рассчитанных на то, чтобы дезориентировать нашу молодежь и отравить ее сознание. Последний из опубликованных рассказов Зощенко «Приключения обезьяны» («Звезда», № 5-6 за 1946 г.) представляет пошлый пасквиль на советский быт и на советских людей. Зощенко изображает советские порядки и советских людей в уродливо карикатурной форме, клеветнически представляя советских людей примитивными, малокультурными, глупыми, с обывательскими вкусами и нравами. Злостно хулиганское изображение Зощенко нашей действительности сопровождается антисоветскими выпадами.
Предоставление страниц «Звезды» таким пошлякам и подонкам литературы, как Зощенко, тем более недопустимо, что редакции «Звезда» хорошо известна физиономия Зощенко и недостойное поведение его во время войны, когда Зощенко, ничем не помогая советскому народу в его борьбе против немецких захватчиков, написал такую омерзительную вещь как «Перед восходом солнца», оценка которой, как и оценка всего литературного «творчества» Зощенко, была дана на страницах журнала «Большевик».
Журнал «Звезда» всячески популяризирует также произведения писательницы Ахматовой, литературная и общественно-политическая физиономия которой давным-давно известна советской общественности. Ахматова является типичной представительницей чуждой нашему народу пустой безыдейной поэзии. Ее стихотворения, пропитанные духом пессимизма и упадочничества, выражающие вкусы старой салонной поэзии, застывшей на позициях буржуазно-аристократического эстетства и декадентства, «искусстве для искусства», не желающей идти в ногу со своим народом наносят вред делу воспитания нашей молодежи и не могут быть терпимы в советской литературе.
Предоставление Зощенко и Ахматовой активной роли в журнале, несомненно, внесло элементы идейного разброда и дезорганизации в среде ленинградских писателей. В журнале стали появляться произведения, культивирующие несвойственный советским людям дух низкопоклонства перед современной буржуазной культурой Запада.
Стали публиковаться произведения, проникнутые тоской, пессимизмом и разочарованием в жизни (стихи Садофьева и Комиссаровой в № 1 за 1946 г. и т.д.). Помещая эти произведения, редакция усугубила свои ошибки и еще более принизила идейный уровень журнала.
Допустив проникновение в журнал чуждых в идейном отношении произведений, редакция понизила также требовательность к художественным качествам печатаемого литературного материала.
Журнал стал заполняться малохудожественными пьесами и рассказами («Дорога времени» Ягдфельдта, «Лебединое озеро» Штейна и т.д.).
Такая неразборчивость в отборе материалов для печатания привела к снижению художественного уровня журнала.
ЦК отмечает, что особенно плохо ведется журнал «Ленинград», который постоянно предоставлял свои страницы для пошлых и клеветнических выступлений Зощенко, для пустых и аполитичных стихотворении Ахматовой. Как и редакция «Звезды», редакция журнала «Ленинград» допустила крупные ошибки, опубликовав ряд произведений, проникнутых духом низкопоклонства по отношению ко всему иностранному. Журнал напечатал ряд ошибочных произведений («Случай над Берлином» Варшавского и Реста, «На заставе» Слонимского). В стихах Хазина «Возвращение Онегина» под видом литературной пародии дана клевета на современный Ленинград. В журнале «Ленинград» помещаются преимущественно бессодержательные низкопробные литературные материалы.
Как могло случиться, что журналы «Звезда» и «Ленинград», издающиеся в Ленинграде, городе-герое, известном своими передовыми революционными традициями, городе, всегда являвшемся рассадником передовых идей и передовой культуры, допустили протаскивание в журналы чуждой советской литературе безыдейности и аполитичности? В чем смысл ошибок редакций «Звезды» и «Ленинграда»? Руководящие работники журналов и, в первую очередь, их редакторы тт. Саянов и Лихарев, забыли то положение ленинизма, что наши журналы, являются ли они научными или художественными, не могут быть аполитичными. Они забыли, что наши журналы являются могучим средством советского государства в деле воспитания советских людей и в особенности молодежи и поэтому должны руководствоваться тем, что составляет жизненную основу советского строя, – его политикой. Советский строй не может терпеть воспитания молодежи в духе безразличия к советской политике, в духе наплевизма и безыдейности.
Сила советской литературы, самой передовой литературы в мире, состоит в том, что она является литературой, у которой нет и не может быть других интересов, кроме интересов народа, интересов государства. Задача советской литературы состоит в том, чтобы помочь государству правильно воспитать молодежь, ответить на ее запросы, воспитать новое поколение бодрым, верящим в свое дело, не боящимся препятствий, готовым преодолеть всякие препятствия.
Поэтому всякая проповедь безыдейности, аполитичности, «искусства для искусства» чужда советской литературе, вредна для интересов советского народа и государства и не должна иметь места в наших журналах.
Недостаток идейности у руководящих работников «Звезды» и «Ленинграда» привел также к тому, что эти работники поставили в основу своих отношений с литераторами не интересы правильного воспитания советских людей и политического направления деятельности литераторов, а интересы личные, приятельские. Из-за нежелания портить приятельских отношений притуплялась критика.
Из-за боязни обидеть приятелей пропускались в печать явно негодные произведения. Такого рода либерализм, при котором интересы народа и государства, интересы правильного воспитания нашей молодежи приносятся в жертву приятельским отношениям и при котором заглушается критика, приводит к тому, что писатели перестают совершенствоваться, утрачивают сознание своей ответственности перед народом, перед государством, перед партией, перестают двигаться вперед.
Все вышеизложенное свидетельствует о том, что редакции журналов «Звезда» и «Ленинград» не справились с возложенным делом и допустили серьезные политические ошибки в руководстве журналами.
ЦК устанавливает, что Правление Союза советских писателей и, в частности, его председатель т. Тихонов, не приняли никаких мер к улучшению журналов «Звезда» и «Ленинград» и не только не вели борьбы с вредными влияниями Зощенко, Ахматовой и им подобных несоветских писателей на советскую литературу, но даже попустительствовали проникновению в журналы чуждых советской литературе тенденций и нравов.
Ленинградский горком ВКП(б) проглядел крупнейшие ошибки журналов, устранился от руководства журналами и предоставил возможность чуждым советской литературе людям, вроде Зощенко и Ахматовой, занять руководящее положение в журналах. Более того, зная отношение партии к Зощенко и его «творчеству», Ленинградский горком (тт. Капустин и Широков), не имея на то права, утвердил решением горкома от 28.I. с.г. новый состав редколлегии журнала «Звезда», в который был введен и Зощенко. Тем самым Ленинградский горком допустил грубую политическую ошибку. «Ленинградская правда» допустила ошибку, поместив подозрительную хвалебную рецензию Юрия Германа о творчестве Зощенко в номере от 6 июля с.г.
Управление пропаганды ЦК ВКП(б) не обеспечило надлежащего контроля за работой ленинградских журналов.
ЦК ВКП(б) постановляет:
1. Обязать редакцию журнала «Звезда», Правление Союза советских писателей и Управление пропаганды ЦК ВКП(б) принять меры к безусловному устранению указанных в настоящем постановлении ошибок и недостатков журнала, выправить линию журнала и обеспечить высокий идейный и художественный уровень журнала, прекратив доступ в журнал произведений Зощенко, Ахматовой и им подобных.
2. Ввиду того, что для издания двух литературно-художественных журналов в Ленинграде в настоящее время не имеется надлежащих условий, прекратить издание журнала «Ленинград», сосредоточив литературные силы Ленинграда вокруг журнала «Звезда».
3. В целях наведения надлежащего порядка в работе редакции журнала «Звезда» и серьезного улучшения содержания журнала, иметь в журнале главного редактора и при нем редколлегию. Установить, что главный редактор журнала несет полную ответственность за идейно-политическое направление журнала и качество публикуемых в нем произведений.
4. Утвердить главным редактором журнала «Звезда» тов. Еголина А.М. с сохранением за ним должности заместителя начальника Управления пропаганды ЦК ВКП(б).
5. Поручить Секретариату ЦК рассмотреть и утвердить состав редакторов отделов и редколлегии.
6. Отменить решение Ленинградского горкома от 26 июня с.г. о редколлегии журнала «Звезда», как политически ошибочное. Объявить выговор второму секретарю горкома тов. Капустину Я.Ф. за принятие этого решения.
7. Снять с работы секретаря по пропаганде и заведующего отделом пропаганды и агитации Ленинградского горкома тов. Широкова И.М., отозвав его в распоряжение ЦК ВКП(б).
8. Возложить партруководство журналом «Звезда» на Ленинградский обком. Обязать Ленинградский обком и лично первого секретаря Ленинградского обкома и горкома тов. Попкова принять все необходимые меры по улучшению журнала и по усилению идейно-политической работы среди писателей Ленинграда.
9. За плохое руководство журналом «Ленинград» объявить выговор тов. Лихареву Б.М.
10. Отмечая, что журнал «Звезда» выходит в свет со значительными опозданиями, оформляется крайне небрежно (обложка меет неприглядный вид, не указывается месяц выхода очередного номера), обязать редакцию «Звезды» обеспечить своевременный выход журнала и улучшить его внешний вид.
11. Возложить на Управление пропаганды ЦК (т. Александрова) контроль за выполнением настоящего постановления.
12. Заслушать на Оргбюро ЦК через 3 месяца отчет главного редактора «Звезды» о выполнении постановления ЦК.
13. Командировать т. Жданова в Ленинград для разъяснения настоящего постановления ЦК ВКП(б).
РГАСПИ, ф. 17, оп. 116, д. 274, л. 7-11, 30.
-
Seite 1
-
Seite 2
-
Seite 3
-
Seite 4
-
Seite 5
-
Seite 6
RGASPI, f. 17, op. 116, d. 274, l. 7-11, 30. Gemeinfrei (amtliches Werk).
РГАСПИ, ф. 17, оп. 116, д. 274, л. 7-11, 30. Общественное достояние (официальный документ).
Oskar Anweiler/Karl-Heinz Ruffmann (Hrsg.), Kulturpolitik der Sowjetunion. Kröner, Stuttgart 1973.
Denis L. Babičenko, Ždanov, Malenkov i delo leningradskich žurnalov [Ždanov, Malenkov und die Affäre der Leningrader Zeitschriften]. In: Voprosy literatury, 3 (1993), S. 201–214, Online.
Denis L. Babičenko (Hrsg.), „Literaturnyj front“: istorija političeskoj cenzury, 1932-1946 gg.: sbornik dokumentov [Die „literarische Front“: Geschichte der politischen Zensur. Dokumentensammlung] (=Pervaja publikacija). Ėnciklopedija rossijskich derevenʹ, Moskva 1994, Online.
Denis L. Babičenko/Lazarʹ I. Lazarev, Pisateli i cenzory: sovetskaja literatura 1940-ch godov pod političeskim kontrolem CK [Schriftsteller und Zensoren: Die sowjetische Literatur der 1940er Jahre unter der politischen Kontrolle des CK]. Rossija Molodaja, Moskva 1994.
David Brandenberger, National Bolshevism: Stalinist Mass Culture and the Formation of Modern Russian National Identity, 1931–1956 (=Russian Research Center studies 93). Harvard Univ. Press, Cambridge, MA u.a. 2002, Online.
E. A. Dobrenko, Metafora vlasti: literatura stalinskoj ėpochi v istoričeskom osveščenii [Die Metapher der Macht: Die Literatur der Stalin-Ära in historischer Perspektive] (=Slavistische Beiträge 302). Otto Sagner, München 1993.
Hans Günther, Der sozialistische Übermensch: M. Gor’kij und der sowjetische Heldenmythos. J.B. Metzler, Stuttgart 1993.
Leonid Heller/Antoine Baudin, Institucional’nyj kompleks socrealizma [Der institrutionelle Komplex des Sozrealismus]. In: Hans Günther, E. A. Dobrenko (Hrsg.), Socrealističeskij kanon. Akademičeskij proekt, Sankt-Peterburg 2000, S. 289–319.
Galina A. Jankovskaja, Iskusstvo, denʹgi i politika: chudožnik v gody pozdnego stalinizma: monografija [Kunst, Geld und Politik: Künstler in den Jahren des Spätstalinismus. Eine Monografie]. Permskij gos. universitet, Permʹ 2007.
G. Kostyrčenko, V plenu u krasnogo faraona: političeskie presledovanija evreev v SSSR v poslednee stalinskoe desjatiletie: dokumentalʹnoe issledovanie [Gefangene des roten Pharaonen: Politische Verfolgung der Juden in der UdSSR im letzten stalinschen Jahrzehnt, Dokumentenforschung]. Meždunarodnye otnošenija, Moskva 1994.
K. Segbers, Die Folgen des Krieges: Die Sowjetunion seit 1945. In: Peter Jahn, Reinhard Rürup (Hrsg.), Erobern und Vernichten: Der Krieg gegen die Sowjetunion 1941-1945: Essays. Argon, Berlin 1991, S. 231–249.
Бабиченко, Д. Л. Жданов, Маленков и дело ленинградских журналов // Вопросы литературы, 1993, Т. 3, c. 201–214, онлайн.
Литературный фронт. История политической цензуры, 1932-1946 гг.: Сборник документов / под ред. Д. Л. Бабиченко. Москва: Энциклопедия российских деревень, 1994 (=Первая публикация), онлайн.
Бабиченко, Д. Л., Лазарев, Л. И. Писатели и цензоры. Советская литература 1940-х годов под политическим контролем ЦК. Москва: Россия молодая, 1994.
Геллер, Л., Боден, А. Институциональный комплекс соцреализма // Соцреалистический канон / под ред. Х. Гюнтера, Е. А. Добренко. Санкт-Петербург: Академический проект, 2000, с. 289–319.
Добренко, Е. А. Метафора власти. Литература сталинской эпохи в историческом освещении. München: Otto Sagner, 1993 (=Slavistische Beiträge 302).
Костырченко, Г. В плену у красного фараона. Политические преследования евреев в СССР в последнее сталинское десятилетие: документальное исследование. Москва: Международные отношения, 1994.
Янковская, Г. А. Искусство, деньги и политика: Художник в годы позднего сталинизма: монография. Пермь: Пермский гос. университет, 2007.
Kulturpolitik der Sowjetunion [Культурная политика Советского Союза] / под ред. O. Anweiler, K.-H. Ruffmann. Stuttgart: Kröner, 1973.
Brandenberger, D. National Bolshevism: Stalinist Mass Culture and the Formation of Modern Russian National Identity, 1931–1956. Cambridge, MA u.a.: Harvard Univ. Press, 2002 (=Russian Research Center studies 93), онлайн.
Günther, H. Der sozialistische Übermensch: M. Gor’kij und der sowjetische Heldenmythos [Социалистический сверхчеловек: М. Горький и миф о советском герое]. Stuttgart: J.B. Metzler, 1993.
Segbers, K. Die Folgen des Krieges: Die Sowjetunion seit 1945 [Последствия войны: Советский Союз с 1945 года] // Erobern und Vernichten: Der Krieg gegen die Sowjetunion 1941-1945: Essays / под ред. P. Jahn, R. Rürup. Berlin: Argon, 1991, с. 231–249.





