Thesen zum gegenwärtigen Moment (vorgeschlagen dem 7. Parteitag durch die Gegner des Friedensvertrages)
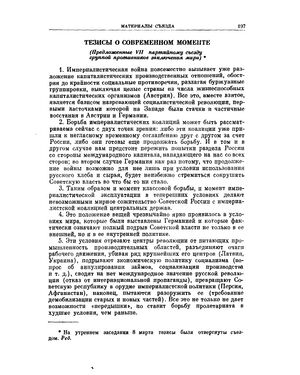
Die „Thesen zum gegenwärtigen Moment“, die die Linken Kommunisten dem VII. (außerordentlichen) Parteitag der RSDRP(b) vorlegten, sind ein Schlüsseldokument für die Geschichte der innerparteilichen bolschewistischen Opposition gegen den Brester Frieden. Darin wurden die Argumente gegen den Friedensvertrag mit Deutschland zusammengefasst und seine Annullierung gefordert. Stattdessen sollte der Krieg in einen „revolutionären Weltbürgerkrieg“ mit dem Ziel der „Weltrevolution“ umgewandelt werden. Auf Druck Lenins wurden die „Thesen“ von der Mehrheit der Delegierten abgelehnt und die Ratifizierung des Friedensvertrages beschlossen. Damit stellte er die Sicherung des Erreichten vor die „Weltrevolution“. Die Ergebnisse des Parteitages begünstigten zugleich die weitere Entwicklung des Staates zur Einparteiendiktatur und zum Bürgerkrieg.
«Тезисы о современном моменте», предложенные VII (экстренному) съезду РСДРП(б) группой левых коммунистов, являются ключевым документом по истории внутрипартийной большевистской оппозиции Брестскому миру. В лаконичной форме в них излагались аргументы против заключения мирного договора с Германией и выдвигалось требование о его аннулировании. В качестве альтернативы авторы «Тезисов» предлагали превратить войну в «мировую революционную войну» с целью «мировой революции». По требованию Ленина эта инициатива была отклонена большинством делегатов съезда. Вместо этого они приняли решение о ратификации мирного договора. Тем самым защита завоеваний революции получила приоритетное значение по сравнению с интересами «мировой революции». В то же время итоги съезда способствовали развитию страны на пути к однопартийной диктатуре и гражданской войне.
Der Friede von Brest war ein Wendepunkt in der Geschichte der russländischen Revolution und zugleich eines der umstrittensten Themen ihrer Historiographie. In den 1920er Jahren zwangen die Parteidisziplin und die Logik des ideologischen Kampfes alle Führer der kommunistischen Opposition, die Position Lenins in der Friedensfrage anzuerkennen. Nach der Etablierung des Stalin-Regimes und der Beschuldigung Bucharins, eine „Verschwörung“ gegen die UdSSR angezettelt zu haben, wurde die Episode mit den Linken Kommunisten als Beginn seiner „Verschwörungstätigkeit“ interpretiert, was eine einigermaßen objektive Betrachtung des Kampfes auf dem VII. Parteitag unmöglich machte. Dabei waren die Argumente der Opposition durch die Veröffentlichung der Dokumente des VII. (außerordentlichen) Parteitages der RSDRP(b) 1923 bereits in vollem Umfang bekannt geworden. Einer der Führer der Opposition – Lev Trockij – legte in seinen Memoiren „Mein Leben“ (1930) die Motive für seine Haltung zum Brester Frieden dar.
Erst in den 1960er Jahren griff die sowjetische Geschichtswissenschaft das Thema wieder auf. Ihre Position wurde weiterhin durch den offiziellen Kurs der „Geschichte der KPSS“ bestimmt. Obwohl der Topos der „Verschwörung“ aus den Interpretationen verschwand, wurden die Positionen Bucharins und Trockijs nach wie vor als schädlich für die „einzig wahre“ leninsche Linie interpretiert. Soweit es damals möglich war, wurde das Thema des Kampfes um den Brester Frieden in der Arbeit von A. Čubar'jan „Der Brester Frieden“ (1963) dargelegt. In der westlichen Sowjethistoriographie wurde das Thema des Brester Friedens in allen umfassenden Darstellungen der Geschichte der kommunistischen Partei behandelt. Die Haltung der Linkskommunisten diente in diesen Studien als Hintergrund, vor dem sie Lenins Politik beschrieben – eine Politik, die Machiavellismus und Pragmatismus in einer Weise verband, wie sie für linke Idealisten unvorstellbar war. Nicht nur R. Pipes, sondern auch der Bucharin-Biograph S. Cohen verstanden den Führer der Linken als einen radikalen Idealisten.
Obwohl sich nach Beginn der Perestrojka der Zugang zu historischen Quellen und die Freiheit des wissenschaftlichen Denkens erweiterte, ging auch die bedeutendste russische Studie dieser Zeit – die Monographie von I. Ksenofontov „Der begehrte und verhasste Frieden“ – von orthodoxen leninschen Positionen aus. Allerdings wurden in dieser Arbeit die Motive der Friedensgegner ausführlicher dargestellt als zuvor. Die gleichzeitig erschienene Monographie des amerikanischen Historikers Yuri Felshtinsky „Der Untergang der Weltrevolution. Brester Frieden, Oktober 1917 – November 1918“ vertrat einen eindeutig antileninschen Standpunkt. Eine detaillierte Darstellung der Mechanismen des politischen Kampfes verband sich hier mit unzureichend belegten Hypothesen (sie bezogen sich auf den Konflikt zwischen Bolschewiki und Linken Sozialrevolutionären), die die Überzeugungskraft der Arbeit schwächten. Felshtinsky lehnte jedoch die etablierte Meinung ab, die Lenins Position als pragmatisch und die seiner Gegner als emotional und idealistisch bewertete. Er zeigte, dass die Motive der Friedensgegner auch auf rationalen Argumenten beruhten. Die vorliegenden „Thesen“ bestätigen dies in aller Deutlichkeit.
Seit Februar 1917 wurde der Friedensschluss zur Schlüsselfrage der russischen Politik. Die Haltung der Bolschewiki zu dieser Frage, die sich im Hinblick auf die künftige Machteroberung als strategisch bedeutsam erweisen sollte, artikulierte sich in zwei Forderungen: Erstens müsse ein Frieden geschlossen werden, wenn auch ein Separatfrieden; und zweitens müsse dieser Frieden für Russland ehrenvoll sein und keine Annexionen und Kontributionen beinhalten. Nachdem die Bolschewiki im Oktober 1917 die Macht erobert und im Dezember 1917 einen Waffenstillstand mit den Deutschen geschlossen hatten, wurden die deutsch-russischen Verhandlungen im Dezember 1917 in Brest-Litovsk wieder aufgenommen. Sie zeigten schnell, dass die deutsche Seite nahm die Parole eines „Friedens ohne Annexionen und Kontributionen“ nicht ernst nahm; sie wertete die Bemühungen Russlands um einen Separatfrieden als Beweis seiner Niederlage und diktierte Bedingungen, die sowohl Annexionen als auch Kontributionen vorsahen. Am 18. Januar 1918 legte die deutsche Delegation der sowjetischen Seite eine Karte vor, auf der eine Linie eingezeichnet war, die fast mit der Frontlinie übereinstimmte. Westlich davon lagen Polen, Litauen und Kurland, auf deren Rechte Russland verzichten sollte.
Darüber hinaus versuchten Deutschland, Österreich-Ungarn und das Osmanische Reich die Tatsache auszunutzen, dass Sowjetrussland Polen, Finnland und den Völkern des Kaukasus und der Ukraine das Selbstbestimmungsrecht gewährte, während es gleichzeitig den Machtkampf der Kommunisten in diesen Gebieten unterstützte. Die Länder des Vierbundes forderten Nichteinmischung in die Angelegenheiten dieser Staaten und hofften, deren Ressourcen nutzen zu können, die für den Sieg im Krieg unentbehrlich schienen. Russland hingegen brauchte diese Ressourcen für den Wiederaufbau seiner Wirtschaft. Das demütigende Abkommen mit den „Imperialisten“ war für die Revolutionäre unannehmbar – sowohl für die Bolschewiki als auch für ihre Regierungspartner, die Linken Sozialrevolutionäre. Deshalb wurde im Rat der Volkskommissare und im CK der RSDRP(b) beschlossen, dass der Volkskommissar für Auswärtige Angelegenheiten Trockij die Verhandlungen so lange wie möglich hinauszögern und im Falle eines deutschen Ultimatums zu Beratungen nach Petrograd zurückkehren sollte.
Am 9. Februar unterzeichneten die Staaten der Vierbundes einen separaten Friedensvertrag mit Vertretern der Ukrainischen Volksrepublik (UNR), die ihre Unabhängigkeit erklärt hatte und erfolglos gegen Sowjetrussland gekämpft hatte. Deutschland und seine Verbündeten planten, Trockij in naher Zukunft ein Ultimatum zu stellen und ihre Truppen auf Einladung der UNR in deren Gebiet einmarschieren zu lassen. Am 10. Februar 1918 verkündete Trockij seine Weigerung, den annektierten Friedensvertrag zu unterzeichnen, erklärte jedoch das Ende des Kriegszustandes und die Demobilisierung der Armee: "Wir können die Gewalt nicht heiligen. Wir ziehen uns aus dem Krieg zurück, aber wir müssen uns weigern, den Friedensvertrag zu unterzeichnen."
Lenin, der angesichts des Zerfalls der alten Armee, der verbreiteten Friedenssehnsucht und des drohenden Bürgerkriegs einen Krieg gegen Deutschland für unmöglich hielt, forderte am 18. Januar die Annahme des Ultimatums, um der Sowjetmacht eine „Atempause“ zu verschaffen. Im Rat der Volkskommissare und dem CK der RSDRP(b) entbrannte eine heftige Diskussion. Lenin, der zugab, dass der Frieden schwierig und demütigend, ja „schändlich“ sei, warf Trockij vor, die Parteidisziplin verletzt zu haben, was schwerwiegende Folgen haben werde: Die Deutschen würden die Offensive wieder aufnehmen und Russland zwingen, einen Frieden unter härteren Bedingungen zu akzeptieren. Trockij gab die Parole aus: „Weder Frieden noch Krieg, und die Armee ist aufzulösen“. Dies bedeutete den Verzicht auf die Unterzeichnung eines Friedensvertrages bei gleichzeitiger Einstellung der Kampfhandlungen und die Auflösung der alten zarischen Armee. Durch die Verzögerung des Friedensschlusses hoffte Trockij, dass Deutschland seine Truppen nach Westen verlegen würde. In diesem Fall wäre die Unterzeichnung des demütigenden Friedens hinfällig geworden.
Die Linken Kommunisten unter Bucharin und die Mehrheit der Linken Sozialrevolutionäre waren ihrerseits der Meinung, dass man die „unterdrückten Völker“ der Ukraine, des Baltikums und anderer Länder Europas nicht der Willkür des imperialistischen Deutschlands überlassen dürfe und gezwungen sei, einen „revolutionären Krieg“, einen „Partisanenkrieg“ gegen den „deutschen Imperialismus“ zu führen. Einen solchen Krieg würde das erschöpfte Deutschland nicht aushalten. Sie hielten den Krieg ohnehin für unvermeidlich, da die Deutschen Sowjetrussland in jedem Fall weiter unter Druck setzen würden, um es zu ihrem Vasallen zu machen. Außerdem, so argumentierten sie, würde der Frieden die Anhänger der Sowjetmacht demoralisieren und der deutschen Regierung zusätzliche Mittel zur Überwindung der sozialen Krise verschaffen. Die Mehrheit des CK stimmte Trockij und Bucharin zunächst zu. Die Position der Linken wurde von der Moskauer und der Leningrader Parteiorganisation sowie von etwa der Hälfte der Parteiorganisationen des Landes unterstützt.
Während im Rat der Volkskommissare und im CK der RSDRP(b) heftige Debatten stattfanden, gingen die Deutschen am 18. Februar zur Offensive über und verlangten, dass auch Estland und Livland (heute das Gebiet von Estland und Lettland) geräumt werden sollten. Am 3. März 1918 eroberten deutsche Soldaten Estland, Narva und Pskov und bedrohten Petrograd. Am 1. März besetzten deutsch-österreichische Truppen Kiew. Die Einheiten der Bolschewiki und die Reste der alten Armee konnten der deutschen Offensive keinen erfolgreichen Widerstand leisten. Aber auch die Deutschen konnten ihren Vormarsch ins Landesinnere nicht fortsetzen.
Lenin, für den die „Machtfrage“ die „Schlüsselfrage jeder Revolution“ war, erkannte, dass ein breiter Widerstand gegen den deutschen Vormarsch nur mit einer stärkeren Unterstützung möglich war, als sie die Sowjetmacht zu diesem Zeitpunkt besaß. Das bedeutete, dass eine Fortsetzung des Krieges zu einer „Machtverschiebung“ von den Bolschewiki und den Linken Sozialrevolutionären hin zu einer breiteren politischen Koalition führen würde, in der die Bolschewiki ihre Führungsposition nicht behaupten könnten. Deshalb war für Lenin eine Fortsetzung des Krieges mit der Folge oder Gefahr eines Vorstoßes ins Landesinnere inakzeptabel. Nachdem Lenin auf Widerstand gestoßen war, drohte er für den Fall, dass die „schädlichen“ Friedensbedingungen nicht akzeptiert würden, mit seinem Rücktritt – einem Schritt, der unter den gegebenen politischen Bedingungen einer Spaltung der bolschewistischen Partei gleichgekommen wäre. Trockij seinerseits erkannte, dass die Spaltung der bolschewistischen Partei einen wirksamen Widerstand gegen den deutschen Einmarsch unmöglich machen würde. Aus dieser Einsicht heraus gab er seinen Widerstand allmählich auf und enthielt sich bei der Abstimmung über den Friedensschluss im CK am 23. Februar der Stimme. Lenin gewann die Mehrheit im CK der Bolschewiki und setzte sich damit auch im Rat der Volkskommissare und im Allrussischen Zentralexekutivkomitee durch, wo die Bolschewiki die Mehrheit hatten. Am 3. März unterzeichnete eine sowjetische Delegation unter Grigorij Sokolnikov in Brest-Litovsk den Frieden. Russland verzichtete auf seine Ansprüche auf Finnland, die Ukraine, das Baltikum und Teile des Kaukasus.
Der Brester Frieden wurde zu einer wichtigen Etappe in der Genese der bolschewistischen Diktatur. Erstens entzog er der Koalition mit den Linken Sozialrevolutionären die Grundlage – sie verließen am 3. März die Regierung. Zweitens zerstörte die Besetzung der Ukraine durch die Deutschen und die anschließende Expansion am Don die Verbindungen zwischen dem Zentrum und den Getreide- und Rohstoffgebieten. Gleichzeitig begannen die Entente-Staaten in Russland zu intervenieren, um die Verluste auszugleichen, die sie durch die russische Kapitulation erlitten hatten. Die Besetzung der Ukraine und anderer Regionen verschärfte die Versorgungsprobleme und die Gegensätze zwischen Stadt und Land. Die Vertreter der Bauernschaft in den Sowjets, die Linken Sozialrevolutionäre, begannen nun eine Agitationskampagne gegen die Bolschewiki. Drittens wurde die Kapitulation gegenüber Deutschland zu einer Herausforderung für das Nationalgefühl des russischen Volkes und brachte Millionen von Menschen gegen die Bolschewiki auf. Solchen Stimmungen konnte sich nur eine strenge Diktatur widerstehen.
Der Frieden mit Deutschland bedeutete keine Abkehr von der Idee der Weltrevolution. Die bolschewistische Führung erkannte, dass ohne einen revolutionären Ausbruch in Deutschland das isolierte Sowjetrussland den Übergang zum Aufbau des Sozialismus nicht bewältigen konnte. Durch die Revolution in Deutschland wurde der Friedensvertrag dann gegenstandslos; unmittelbar nach Ausbruch der Novemberrevolution wurde er am 13. November 1918 aufgekündigt.
Diese Fragen wurden auf dem VII. (außerordentlichen) Parteitag der RSDRP(b) vom 6. bis 8. März 1918 erörtert. An der Abstimmung über den Friedensvertrag nahmen 47 Delegierte mit entscheidender Stimme und 59 Delegierte mit beratender Stimme (darunter Lenin und Bucharin) teil. Lenin hielt auf dem Parteitag eine Rede, in der er die Notwendigkeit der Ratifizierung des Friedensvertrags begründete. Schon eine kleine Offensive der Deutschen würde Russland unweigerlich in den Untergang führen. Bucharin trat mit einem Koreferat gegen den Frieden auf und bewies seinerseits, dass der Frieden keine Atempause gewähren würde, dass „das Schaffell der Gerbung nicht lohne“ und dass die negativen Folgen des Friedens viel größer seien als seine positiven. Notwendig sei ein unverzüglicher „revolutionärer Krieg gegen den deutschen Imperialismus“, der als Partisanenkrieg beginnen und nach der Stärkung der Roten Armee und der Schwächung Deutschlands, das gleichzeitig in Kämpfe an der Westfront verwickelt sei, in einen regulären Krieg übergehen müsse. M. Urickij, K. Radek, G. Oppokov, A. Bubnov, D. Rjazanov und einige andere stimmten dieser Position entschieden zu.
Die Grundaussagen seines Vortrags legte Bucharin noch einmal in den „Thesen“ dar. Ziel dieses Dokuments war es, die Delegierten dazu zu bewegen, gegen die Ratifizierung des Brester Friedens zu stimmen und den Kurs auf einen „revolutionären Krieg“ zu billigen. Die „Thesen“ fassten die wichtigsten Argumente zusammen, die dafür sprachen, dass der Frieden keine reale „Atempause“ bringen würde, während ein „revolutionärer Krieg“ der Festigung der revolutionären Bewegung in Russland und in der Welt und letztlich der Weltrevolution dienen würde. In einem Punkt waren Lenin und seine Anhänger jedoch nicht zu bekehren: in ihrer Überzeugung, dass die Sowjetmacht eine Atempause brauche, um wieder zu Kräften zu kommen. Eine Reihe von Bucharins Vorschlägen – die Mobilisierung der Arbeiter, entschiedene soziale Maßnahmen zur Zerschlagung des russischen Kapitals, die Schaffung internationaler kommunistischer Brigaden – flossen später in Lenins Überlegungen ein.
Über den Ausgang des Parteitages entschied die Autorität Lenins – seine Resolution wurde mit 30 zu 12 Stimmen bei 4 Enthaltungen angenommen. Trockijs Kompromissvorschlag, Brest als letztes Zugeständnis zu betrachten und dem CK zu verbieten, Frieden mit der ukrainischen Zentralrada zu schließen, wurde abgelehnt. Die Linken Kommunisten weigerten sich, sich am neuen CK zu beteiligen, was als Schritt zur Spaltung der Partei gewertet wurde.
Wären die Linken Kommunisten aus der Partei ausgetreten und hätten sie sich mit den Linken Sozialrevolutionären verbündet, hätten sie eine Stimmenmehrheit auf dem Sowjetkongress erringen können. Aber sie wagten es nicht, gegen den Rest der Partei zu stimmen. Auf dem darauffolgenden IV. Sowjetkongress, der am 15. März 1918 den Brester Frieden ratifizierte, enthielten sie sich der Stimme.
Text und Übersetzung: CC BY-SA 4.0
Брестский мир является одним из переломных моментов в истории российской революции и одновременно одной из наиболее дискуссионных тем ее историографии. В 20-х гг. партийная дисциплина и логика идейно-политической борьбы заставили всех лидеров коммунистической оппозиции признать правоту Ленина в вопросе о мире. После установления сталинского режима и обвинения Бухарина в «заговоре» против СССР эпизод с левыми коммунистами трактовался как начало его заговорщической деятельности, и сколько-нибудь объективное рассмотрение дискуссий и борьбы на VII (экстренном) съезде РСДРП(б) стало невозможным. Однако уже в материалах VII съезда партии, опубликованных в 1923 г., аргументы оппозиции были представлены полно. Наконец, один из лидеров оппозиции, Лев Троцкий, обосновал свою позицию по вопросу о мирном договоре 1918 г. в мемуарах «Моя жизнь» (1930).
Советская историография вернулась к этой проблеме только в 60-е гг. На тот момент ее точка зрения определялась официальным курсом «Истории КПСС». Хотя тема «заговора» в исследованиях этих лет исчезает, позиции Бухарина и Троцкого по-прежнему трактовались как враждебные «единственно верной» ленинской линии. Насколько позволяли условия времени, тема борьбы вокруг Брестского мира была изложена в работе А. Чубарьяна «Брестский мир» (1963). В зарубежной историографии Брестский мир затрагивался во всех комплексных исследованиях по истории коммунистической партии. Для авторов этих исследований позиция левых коммунистов являлась прежде всего фоном для характеристики политики Ленина как сочетания макиавеллизма и прагматизма, неслыханного для левых идеалистов. Не только Р. Пайпс, но и биограф Н. Бухарина С. Коэн воспринимали лидера левых как идеалиста-радикала.
Хотя с началом Перестройки доступ к историческим источникам расширился, а свобода научной мысли возросла, крупнейшее российское исследование этого периода, монография И. Ксенофонтова «Мир, которого хотели и который ненавидели», была написана с ортодоксальных проленинских позиций. Однако мотивы противников мира были представлены в этой работе уже более подробно. В вышедшей почти одновременно с ней монографии американского исследователя Ю. Фельштинского «Крушение мировой революции. Брестский мир. Октябрь 1917 г. – ноябрь 1918 г.», напротив, преобладал антиленинский взгляд на проблему. К сожалению, здесь имело место не только подробное описание механизма политической борьбы этого периода, но и выдвигался ряд мало доказанных гипотез (они касались прежде всего конфликта между большевиками и левыми эсерами), от которых пострадала убедительность работы. В то же время Фельштинский нарушил традицию, согласно которой позиция Ленина оценивалась как прагматичная, а позиция его оппонентов – как эмоциональная и идеалистическая. Он показал, что точка зрения противников мирного договора равным образом опиралась на рациональные аргументы.
Начиная с февраля 1917 г. заключение мирного договора являлось одним из ключевых вопросов российской политики. Позиция большевиков в этом вопросе, который приобрел для них стратегически важное значение с точки зрения завоевания власти в будущем, выражалась в двух требованиях: 1) нужно заключить мир, даже если он будет сепаратным; 2) этот мир должен стать для России почетным и не предусматривать аннексий и контрибуций. В декабре 1917 г., после того, как большевики пришли к власти и заключили перемирие с немцами, начались российско-германские переговоры в Брест-Литовске. Уже вскоре они показали: германская сторона не только не воспринимает всерьез лозунг «мира без аннексий и контрибуций», но и считает стремление России к заключению сепаратного мира свидетельством ее поражения и готова диктовать условия, предполагающие и аннексии, и контрибуции. 18 января 1918 г. германская делегация предъявила советской карту, на которой была начерчена линия, почти совпадающая с линией фронта. К западу от нее находились Польша, Литва и Курляндия, от прав на которые Россия должна была отказаться.
Кроме того, Германия, Австро-Венгрия и Османская империя пытались воспользоваться тем обстоятельством, что Советская Россия предоставила формальное право на самоопределение Польше, Финляндии, Украине и Закавказью, поддерживая, однако, борьбу коммунистов за власть в этих регионах. Страны Четверного союза требовали невмешательства в дела этих стран, надеясь воспользоваться их ресурсами, необходимыми для победы в войне. Однако Россия столь же остро нуждалась в этих ресурсах для восстановления своей экономики. Унизительное соглашение с «империалистами» было неприемлемо для революционеров – как для коммунистов-большевиков, так для их партнеров по правительству, левых эсеров. В итоге, в Совнаркоме и ЦК РСДРП(б) было принято решение о том, что нарком иностранных дел Троцкий должен затягивать переговоры как можно дольше, а после выдвижения немцами ультиматума выехать в Петроград для консультаций.
9 февраля государства Четверного союза подписали сепаратный мирный договор с представителями Украинской народной республики (УНР), провозгласившей независимость и неудачно воевавшей с Советской Россией. Германия и ее союзники планировали предъявить Троцкому ультиматум в ближайшее время и ввести свои войска на территорию УНР по ее приглашению. 10 февраля 1918 г. Троцкий провозгласил, что отказывается подписать аннексионистский мирный договор, заявив, тем не менее, о прекращении состояния войны и демобилизации армии: «Мы не можем освящать насилия. Мы выходим из войны, но мы вынуждены отказаться от подписания мирного договора».
Ленин, считавший, что в условиях разложения старой армии, широкого стремления к миру и угрозы гражданской войны вести войну с Германией нельзя, потребовал принять условия 18 января с тем, чтобы обеспечить Советской власти «передышку». Разгорелась острая дискуссия в Совнаркоме и ЦК РСДРП(б). Хотя Ленин признавал, что мир будет тяжелым и позорным («похабным»), он обвинял Троцкого в нарушении дисциплины, грозившем тяжелыми последствиями. Ленин опасался, что немцы возобновят наступление и заставят Россию принять мир на еще более тяжелых условиях. Троцкий выступил с призывом: «Не мира, ни войны, а армию распустить». Это означало не только отказ от подписания мира, но и роспуск старой царской армии. Оттягивая подписание мира, Троцкий рассчитывал на то, что Германия перебросит войска на Запад. В этом случае уже не нужно было бы подписывать «похабный» мир.
В свою очередь левые коммунисты во главе с Николаем Бухариным и большинство левых эсеров считали, что нельзя бросать «угнетенные народы» Украины, Прибалтики и других стран Европы на произвол империалистической Германии и нужно вести «революционную», партизанскую войну против «германского империализма». Такой войны изнуренная Германия не выдержит. Они исходили из того, что война все равно неизбежна, что немцы в любом случае продолжат оказывать давление на Советскую Россию, стремясь превратить ее в своего вассала. В качестве дополнительного аргумента они указывали на то, что заключение мира деморализует сторонников Советской власти и даст Германии в руки дополнительные средства для преодоления социального кризиса. Большинство ЦК первоначально встало на сторону Троцкого и Бухарина. Позиция левых получила поддержку Московской и Петроградской парторганизаций, а также примерно половины парторганизаций страны.
Пока в Совнаркоме и ЦК РСДРП(б) шли острые споры, 18 февраля немцы перешли в наступление и потребовали очистить также Эстляндию и Лифляндию (ныне территория Эстонии и Латвии). К 3 марта 1918 г. германские войска захватили Эстонию, Нарву и Псков и стали угрожать Петрограду. 1 марта австро-германские войска заняли Киев. Большевистские отряды и остатки старой армии не смогли оказать успешного сопротивления немецкому наступлению. Однако и немцы уже едва ли были в состоянии продолжать свое продвижение вглубь России.
Ленин, для которого «вопрос о власти» был «ключевым вопросом всякой революции», понимал, что сопротивление вторжению немцев на всей линии фронта возможно лишь в том случае, если представители других политические сил окажут Советской власти большую поддержку, чем до сих пор. Это означало, что продолжение войны приведет к «перемещению центра власти» с большевиков и левых эсеров на более широкую политическую коалицию, в рамках которой большевики могут утратить свою господствующую позицию. Поэтому для Ленина продолжение войны и, как следствие, отступление вглубь России были неприемлемы. Наткнувшись на сопротивление, Ленин пригрозил, что в том случае, если «похабные» условия мира не будут приняты, он подаст в отставку. В политической ситуации того времени этот шаг был чреват расколом партии большевиков. В свою очередь Троцкий понимал, что в случае раскола РСДРП(б) организовать успешное сопротивление немецкому вторжению будет невозможно. Поэтому он отказался от дальнейшего сопротивления и воздержался при голосовании по вопросу о мире в ЦК 23 февраля. Ленин получил большинство в ЦК большевиков, после чего его позиция возобладала в Совнаркоме и Всероссийском центральном исполнительном комитете, где у большевиков было большинство. 3 марта советская делегация во главе с Григорием Сокольниковым подписала мир в Брест-Литовске. По его условиям, Россия отказывалась от прав на Финляндию, Украину, Прибалтику и часть Закавказья.
Брестский мир стал новым этапом генезиса большевистской диктатуры. Во-первых, коалиция с левыми эсерами становилась невозможной, и 3 марта они покинули правительство. Во-вторых, ввиду германской оккупации Украины (с последующей экспансией на Дону) были нарушены связи между центром страны и хлебными и сырьевыми районами. Одновременно для Советской России стала реальной угроза интервенции государств Антанты, которые стремились снизить свои издержки из-за капитуляции их бывшего союзника. Оккупация Украины и других регионов усугубляла продовольственную проблему и дополнительно обостряла отношения между городом и деревней. Левые эсеры, представлявшие интересы крестьянства в Советах, развернули теперь агитационную кампанию против большевиков. В-третьих, капитуляция перед Германией стала вызовом национальным чувствам русского народа, настроив против большевиков миллионы людей. Только жесткая диктатура могла успешно противостоять таким настроениям.
Мир с Германией не означал отказа от идеи мировой революции как таковой. Большевистское руководство сознавало, что без революционного взрыва в Германии Советская Россия, находившаяся в международной изоляции, не сможет перейти к строительству социализма. Революция в Германии делала мирный договор бессмысленным; сразу после начала Ноябрьской революции он был аннулирован 13 ноября 1918 г.
Эти проблемы обсуждались на VII (экстренном) съезде РСДРП(б), который заседал с 6-го по 8-ое марта 1918 г. В голосованиях приняли участие 47 делегатов с решающим голосом и 59 – с совещательным (в т.ч. Ленин и Бухарин). С докладом на съезде выступил Ленин, приводивший аргументы в пользу ратификации мирного договора. Он утверждал, что «мы погибли бы при малейшем наступлении немцев неизбежно и неминуемо». С содокладом, направленным против договора, выступил Бухарин, который в свою очередь пытался доказать, что мир не дает желаемой «передышки», что «овчинка выделки не стоит», и отрицательные последствия мира ставят гораздо больше, чем его положительные стороны. Срочно необходимо, продолжал он, начать «революционную войну против германского империализма», которую следует поначалу вести в партизанских формах, а затем, по мере укрепления Красной армии и ослабления Германии, которая одновременно ведет сражения на Западном фронте, превратить в регулярную войну. Эту позицию активно поддержали М. Урицкий, К. Радек, Г. Оппоков, А. Бубнов, Д. Рязанов и др.
Основные идеи доклада Бухарина были изложены в «Тезисах». Цель этого документа заключалась в том, чтобы убедить делегатов съезда в необходимости проголосовать против ратификации мирного договора, за курс на «революционную войну». В «Тезисах» приводились в краткой форме основные аргументы, доказывающие, что мир не принесет реальной «передышки», а «революционная война» будет способствовать укреплению революционного движения как в России, так и во всем мире, и в конечном итоге – мировой революции. Однако Ленин и его сторонники остались непреклонны во мнении, что Советская власть нуждается в передышке для организации своих сил. Ряд предложений Бухарина (например, мобилизация рабочих, превращение их из пролетариев в солдат, решительные социальные мероприятия по ниспровержению российского капитала, создание интернациональных коммунистических отрядов) позже будут использованы Лениным.
Исход съезда решил авторитет Ленина – его резолюция была принята 30 голосами против 12, при 4 воздержавшихся. Компромиссные предложения Троцкого считать Брест последней уступкой и запретить ЦК заключать мир с Центральной радой Украины были отвергнуты. Левые коммунисты отказались входить в новый ЦК, что было воспринято как шаг к расколу.
Если бы левые коммунисты вышли из РСДРП(б) и объединились с левыми эсерами, они могли бы бороться за большинство на Съезде Советов. Но они не решились голосовать против своей партии. На IV Съезде Советов, который 15 марта 1918 г. ратифицировал Брестский мир, они оказались среди воздержавшихся при голосовании.
Текст: CC BY-SA 4.0
Thesen zum gegenwärtigen Moment (vorgeschlagen dem 7. Parteitag durch die Gegner des Friedensvertrages)
1. Der imperialistische Krieg verursacht bereits überall die Auflösung der kapitalistischen Produktionsverhältnisse, verschärft die sozialen Gegensätze aufs äußerste, zersetzt die bourgeoisen Gruppierungen und untergräbt, wie im Falle Österreichs, die Lebensfähigkeit einer Anzahl kapitalistischer Organismen. All das zusammengenommen bildet den Nährboden für die reifende sozialistische Revolution, deren erste Anzeichen im Westen die Streiks und die verschiedenen Erhebungen in Österreich und Deutschland waren.
2. Der Krieg der imperialistischen Koalitionen kann jetzt von zwei Gesichtspunkten her betrachtet werden: Die Koalitionen sind entweder zeitweilig und geheim untereinander auf Rußlands Kosten einig geworden, oder sie sind noch immer zur Fortsetzung des Krieges bereit. In beiden Fällen müssen wir uns auf Anschläge des internationalen Kapitals gefaßt machen, die von allen Seiten her eine Teilung Rußlands anstreben. Im zweiten Fall wird Deutschland, gerade weil es den Krieg nur dadurch verlängern kann, daß es sich in den Besitz russischer Kornkammern und Rohmaterialien setzt, das Sowjetregime um jeden Preis vernichten wollen.
3. So machen daher sowohl der Klassenkampf als auch die imperialistische Ausbeutung unter den gegenwärtigen Umständen die friedliche Koexistenz Sowjetrußlands mit der imperialistischen Koalition der Zentralmächte unmöglich.
4. Dieser Zustand kam mit größter Klarheit in den Friedensbedingungen zum Ausdruck, die von Deutschland gestellt wurden und die in Wirklichkeit sowohl auf die Unterminierung der äußeren als auch der inneren Politik des Sowjetregimes hinauslaufen.
5. Diese Umstände schneiden die Zentren der Revolution von den Ernährungsquellen der Industriebevölkerung ab, zerteilen die Zentren der Arbeiterbewegung und zerstören einige der wichtigsten Industriegebiete (Lettland, Ukraine); sie unterhöhlen die Wirtschaftspolitik des Sozialismus (die Frage der Annullierung der Anleihen, die Sozialisierung der Produktion etc.), bagatellisieren die internationale Bedeutung der russischen Revolution (Verzicht auf die internationale Propaganda), verwandeln die Sowjetrepublik in ein Werkzeug imperialistischer Politik (Persien, Afghanistan) und erstreben schließlich ihre Entwaffnung (die Forderung nach der Demobilisierung alter und neuer Einheiten). All das bietet nicht die Möglichkeit einer Atempause, sondern verschlechtert nur die Kampfbedingungen des Proletariats mehr denn je.
6. Ohne wirklich einen Aufschub zu gewähren, schwächt die Unterzeichnung des Friedens den revolutionären Willen des Proletariats zum Kampfe und hält die Entwicklung der internationalen Revolution auf. Die einzig korrekte Taktik würde daher die Taktik des revolutionären Krieges gegen den Imperialismus sein.
7. Angesichts der völligen Auflösung der alten Armee, deren Überreste weniger als nichts taugen, kann der revolutionäre Krieg in seinem ersten Stadium nur mit Hilfe fliegender Partisanenabteilungen geführt werden, die sowohl das Stadtproletariat als auch die ärmste Bauernschaft in den Kampf ziehen und die militärischen Handlungen, was uns angeht, in einen Bürgerkrieg der arbeitenden Klassen gegen das internationale Kapital verwandeln werden. Ein solcher Krieg würde trotz aller anfänglichen Niederlagen schließlich die Streitkräfte des Imperialismus zersetzen.
8. Außerdem würde die Mobilisierung des Proletariats, das infolge der Arbeitslosigkeit und des allgemeinen wirtschaftlichen Zusammenbruchs seine Bedeutung als schaffende Schicht verliert, die Gefahr der proletarischen Desorganisation bannen und aus den Arbeitslosen Soldaten der proletarischen Revolution machen.
9. Das Grundziel der Partei muß daher eine klare taktische Linie sein, die auf dem Krieg mit dem Imperialismus beruht und die Verteidigung des Sozialismus in diesem Krieg mit dem höchsten Nachdruck organisiert. Die Kampfkraft einer sozialistischen Armee wird gerade durch den unmittelbaren Kampf selbst geschaffen.
10. Die Politik der führenden Organe unserer Partei war eine Politik der Schwankungen und der Kompromisse – eine Politik, die objektiv die proletarischen Widerstandsvorbereitungen hemmte und infolge ihres ständigen Schwankens selbst jene beispielhaften Abteilungen demoralisierte, die sich begeistert in den Kampf stürzten.
11. Die soziale Grundlage einer solchen Politik war die Verwandlung unserer Partei aus einer rein proletarischen in eine „allgemeine Volkspartei“, ein Vorgang, der angesichts ihres riesigen Wachstums unvermeidlich war. Die Massen der Soldaten, die um jeden Preis und zu allen Bedingungen Frieden haben wollten und gar nicht mit dem sozialistischen Charakter der Regierung des Proletariats rechneten, machten ihren Einfluß geltend, die Partei sank auf das Niveau der Bauernmassen zurück, statt diese auf ihr eigenes Niveau emporzuheben, und verwandelte sich aus einer Avantgarde der Revolution in eine „mittelmäßige“ Organisation.
12. Überdies wird selbst die Bauernschaft im Falle eines weiteren Kampfes mit dem internationalen Imperialismus unvermeidlich in diesen Kampf hineingezogen, weil sie sich von der großen Gefahr des Landverlustes bedroht sehen muß.
13. Unter diesen Bedingungen sind die Ziele der Partei und der Sowjetregierung:
a) Die Annullierung des Friedensvertrages.
b) Verstärkte Propaganda und Agitation gegen das internationale Kapital, die die Bedeutung dieses neuen Bürgerkrieges in das richtige Licht rücken.
c) Die Schaffung einer schlagkräftigen Roten Armee; die Bewaffnung der Proletariats und der Bauernbevölkerung und die geeignete Unterweisung der letzteren in der Kriegstechnik.
d) Entschiedene soziale Maßnahmen, die die Bourgeoisie ökonomisch vernichten, das Proletariat einen und die Begeisterung der Massen verstärken.
e) Unerbittlicher Kampf mit der Konterrevolution und dem Versöhnlertum.
f) Intensivste internationale revolutionäre Propaganda und Rekrutierung von Freiwilligen aller Nationalitäten und Staaten für die Rote Armee.
Rev. Übersetzung hier nach: Altrichter, H. (Hrsg.), Die Sowjetunion. Von der Oktoberrevolution bis zu Stalins Tod, Bd. 1: Staat und Partei, München 1985, S. 66ff.
Тезисы о современном моменте (предложенные VII партийному съезду группой противников заключения мира)
1. Империалистическая война повсеместно вызывает уже разложение капиталистических производственных отношений, обостряя до крайности социальные противоречия, разлагая буржуазные группировки, выключая целые страны из числа жизнеспособных капиталистических организмов (Австрия). Все это, вместе взятое, является базисом назревающей социалистической революции, первыми ласточками которой на Западе были стачки и частичные восстания в Австрии и Германии.
2. Борьба империалистических коалиций может быть рассматриваема сейчас с двух точек зрения: либо эти коалиции уже пришли к негласному временному соглашению друг с другом за счет России, либо они готовы еще продолжать борьбу. И в том, и в другом случае нам предстоит пережить попытки раздела России со стороны международного капитала, нападающего на нас со всех сторон; во втором случае Германия как раз потому, что продолжение войны возможно для нее лишь при условии использования русского хлеба и сырья, будет неизбежно стремится сокрушить Советскую власть во что бы то ни стало.
3. Таким образом и момент классовой борьбы, и момент империалистической эксплуатации в теперешних условиях делают невозможными мирное сожительство Советской России с империалистической коалицией центральных держав.
4. Это положение вещей чрезвычайно ярко проявилось в условиях мира, которые были выставлены Германией и которые фактически означают полный подрыв Советской власти не только в ее внешней, но и в ее внутренней политике.
5. Эти условия отрезают центры революции от питающих промышленность производительных областей, разъединяют очаги рабочего движения, убивая ряд крупнейших его центров (Латвия, Украина), подрывают экономическую политику социализма (вопрос об аннулировании займов, социализация производства и т.д.), сводят на нет международное значение русской революции (отказ от интернациональной пропаганды), превращают Советскую республику в орудие империалистической политики (Персия, Афганистан), наконец, пытаются разоружить ее (требование демобилизации старых и новых частей). Все это не только не дает возможности «передышки», но ставит борьбу пролетариата в худшие условия, чем раньше.
6. Не давая никакой отсрочки по существу, подписание мира разлагает революционную волю пролетариата к борьбе, задерживает развязывание международной революции. Поэтому единственно правильной тактикой могла бы быть тактика революционной войны против империализма.
7. При полном разложении старой армии, остатки которой являются лишь вредным балластом, революционная война в своей начальной стадии может быть только войной партизанских летучих отрядов, втягивающих в борьбу как городской пролетариат, так и беднейшее крестьянство и превращающая военные действия с нашей стороны в гражданскую войну трудящихся классов с международным капиталом. Такая война, какие бы она поражения не сулила в начале, неизбежно разлагала бы силы империализма.
8. Кроме того, в условиях распада пролетариата как производительного класса в связи с безработицей и общей экономической разрухой мобилизация пролетарской армии удерживала бы пролетариат от распада и закрепляла бы кадры безработных как солдат пролетарской революции.
9. Поэтому основной задачей партии является ясная тактическая линия войны с империализмом и интенсивнейшая работа по организации обороны социализма в процессе этой войны. Именно в этом процессе непосредственного столкновения создается боеспособная социалистическая армия.
10. Между тем политика руководящих учреждений партии была политикой колебаний и компромиссов, — политикой, которая объективно мешала делу подготовки революционного отпора и постоянными колебаниями деморализовала даже те передовые отряды, которые с энтузиазмом шли в бой.
11. Социальной основой такой политики был процесс перерождения нашей партии из чисто пролетарской в «общенародную», что не могло не происходить при ее гигантском росте. Солдатская масса, желавшая мира во что бы то ни стало, при всех и всяких условиях, не считаясь даже с социалистической характером государственной власти пролетариата, наложила свой отпечаток, и партия, вместо того, чтобы поднимать до себя крестьянские массы, спустилась сама до их уровня, из авангарда революции превратилась в «середняка».
12. Между тем даже крестьянство при дальнейшей борьбе с международным империализмом вовлекаться в эту борьбу, так как ему угрожает громадная опасность потерять землю.
13. При таких условиях задачей партии и задачей Советской власти является:
1. Аннулирование договора о мире.
2. Усиленная пропаганда и агитация против международного капитала, разъясняющая смысл этой новой гражданской войны.
3. Создание боеспособной Красной Армии; вооружение пролетарского и крестьянского населения и правильное обучение военной технике.
4. Решительные социальные мероприятия, добивающие буржуазию экономически, сплачивающие пролетариат и поднимающие энтузиазм масс.
5. Беспощадная борьба с контрреволюцией и соглашательством.
6. Самая интенсивная международно-революционная пропаганда и привлечение в ряды Красной Армии добровольцев всех национальностей.
Седьмой экстренный съезд РКП(б). Март 1918 года. Стенографический отчет, Москва 1962, с. 197-199.
-
Seite 1
-
Seite 2
-
Seite 3
Sed'moj ėkstrennyj s"ezd RKP(b) Mart 1918 goda. Stenografičeskij otčet [Siebter Außerordentlicher Kongress der RKP(b). März 1918. Stenografischer Bericht], S. 197-199, Online. Gemeinfrei (amtliches Werk).
Источник: Седьмой экстренный съезд РКП/б/ март 1918 года. Стенографический отчет, с. 197-199, онлайн. Общественное достояние (официальный документ).
Stephen F. Cohen, Bukharin and the Bolshevik Revolution: A Political Biography, 1888–1938. Vintage Books, New York 1975, Online.
Richard K. Debo, Revolution and Survival: The Foreign Policy of Soviet Russia, 1917–18. Liverpool Univ. Press, Liverpool 1979.
Richard K. Debo, Survival and Consolidation: The Foreign Policy of Soviet Russia, 1918–1921. McGill-Queen’s Univ. Press, Montreal Kingston London 1992.
Jurij G. Fel’štinskij, Krušenie mirovoj revoljucii. Brestskij mir. Oktjabr’ 1917 g. – nojabr’ 1918 g [Der Zusammenbruch der Weltrevolution. Der Brester Frieden. Oktober 1917 – November 1918]. TERRA, Moskva 1992.
I. N. Ksenofontov, Mir, kotorogo choteli i kotoryj nenavideli: Dokumental’nyj reportaž [Der begehrte und verhasste Frieden]. Politizdat, Moskva 1991.
Lev Davidovič Trockij, Mein Leben: Versuch einer Autobiographie. Dietz, Berlin 1990, Online.
Sed’moj ėkstrennyj s’’ezd RKP(b), mart 1918 goda. Stenografičeskij otčet [Der siebte Sonderparteitag der RKB(b), März 1918. Stenografischer Bericht]. Politizdat, Moskva 1962.
Коэн, С. Бухарин: политическая биография, 1888-1938. Москва: Прогресс, 1988.
Ксенофонтов, И. Н. Мир, которого хотели и который ненавидели: Документальный репортаж. Москва: Политиздат, 1991.
Троцкий, Л. Д. Моя жизнь. Москва: Книга, 1990.
Фельштинский, Ю. Г. Крушение мировой революции. Брестский мир. Октябрь 1917 г. – ноябрь 1918 г. Москва: ТЕРРА, 1992.
Седьмой экстренный съезд РКП(б), март 1918 года. Стенографический отчет. Москва: Политиздат, 1962.
Debo, R. K. Revolution and Survival: The Foreign Policy of Soviet Russia, 1917–18. Liverpool: Liverpool Univ. Press, 1979.
Debo, R. K. Survival and Consolidation: The Foreign Policy of Soviet Russia, 1918–1921. Montreal Kingston London: McGill-Queen’s Univ. Press, 1992.


